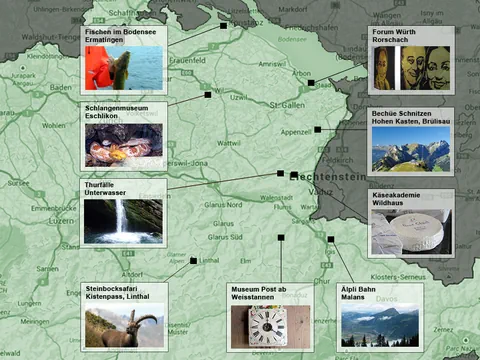Link zum Thema
Vor rund fünf Jahren machte der Fall Schlagzeilen: Ein Franzose hatte im Streit um das Sorgerecht seine sechs und sieben Jahre alten Söhne ihrer Mutter entrissen und war mit ihnen in die Wildnis abgetaucht. Über zehn Jahre lang verlief die Suche nach ihnen erfolglos. Anonym, von Schwarzarbeit und Tierzucht lebend, verschanzte sich das Trio in Südfrankreich, bis die Sache aufflog: Die Jungs wurden aufgrund von Fahndungsfotos erkannt. Der Vater kam schliesslich mit einer milden Strafe davon, denn beide Söhne stellten sich hinter ihn.
Lose um die Wahrheit konstruiert
Der Autor und Regisseur Jean Denizot hat seinen ersten Spielfilm lose um diese wahre Begebenheit konstruiert. Doch «La belle vie» erhebt keinen Anspruch auf Authentizität. Denizot interessiert sich nur bedingt für ein Aufrollen der Fakten, er sorgt sich primär um den romanesken Gehalt seiner Geschichte.
Die klassische Erzählung «Walden» von Henry David Thoreau schwingt hier mit, was den zwanghaft naturverbundenen Vater anbetrifft, die Söhne hingegen scheinen in ihrer Lust an einem Leben jenseits zivilisatorischer Zwänge mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn verwandt zu sein – oder gar mit Mowgli aus dem Dschungelbuch.
Kein Dauerstreit
Denizot hat die Handlung von Südfrankreich an die Loire verlegt – in eine Landschaft, die er genüsslich im Breitleinwandformat und im sommerlichen Gewand abfilmt. «La belle vie» erzählt auch gar nicht die langwierige Geschichte der anhaltenden Flucht, sondern er konzentriert sich auf eine entscheidende Momentaufnahme: Der Moment des Erwachsenwerdens der beiden Söhne, und damit ihre bevorstehende Abnabelung vom Vater.
Natürlich ist die Situation geprägt von Konflikten – die beiden Söhne pubertieren und rebellieren, sie wünschen sich bisweilen ein Leben in einer festen Bleibe und ohne Fahnder auf den Fersen. Der jüngere der beiden Knaben verliebt sich in ein Mädchen, was natürlich nicht kompatibel ist mit der nomadischen Lebensweise seines Vaters. Doch all diese Konflikte – und das ist das Schöne an dem Film – bleiben sekundär: Es wird erstaunlich selten gestritten in «La belle vie». Die Dinge geschehen, und die Figuren nehmen sie hin.
Das Leben, ein Fluss
«La belle vie» berührt sein Publikum, weil er die zahlreichen psychologischen Ticks umschifft, die so viele Familiendramen schwerfällig werden lassen. Wir befinden uns hier in einer Welt, in der Mark Twain regiert, und nicht Sigmund Freud. Die Natur spielt die Hauptrolle, die Landschaft scheint die Menschen in ihrem Schoss zu umsorgen, und die Loire – schön wie der Mississippi – ist ein eindeutiges Sinnbild für das Leben der beiden Knaben, die im Erwachsensein und in der Zivilisation ankommen, wie der Fluss ins Meer münden wird.
Natürlich wird sich das in der Realität nicht ganz so reibungslos zugetragen haben. Aber wie gesagt – der Film sucht diese Wahrheit gar nicht. Er sucht vielmehr nach der Schönheit in den Dingen, sowohl im Abschied von der wilden Kindheit als auch in der Ankunft in einem neuen, normaleren Leben. Um «La belle vie» geht es hier, wortwörtlich.