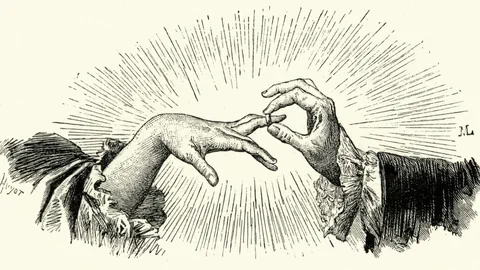Ruedi Geiger ist eigentlich dagegen, dass Homosexuelle diskriminiert werden. Als 2005 auf nationaler Ebene über die eingetragene Partnerschaft abgestimmt wurde, war er klar für die Rechte Homosexueller: «Das schein mir berechtigt. Denn wie es vorher war, war wirklich diskriminierend.»
Damals war für den pensionierten Chemiker aber ebenso klar, dass eine Ehe für alle zu weit gehe. Er sah die Gefahr, «dass ein Dammbruch stattfindet und es uferlos wird» – eine Befürchtung, die nun auch andere Gegnerinnen und Gegner der «Ehe für alle» teilen.
«Das Verhältnis Mann-Frau ist etwas ganz Besonderes»
Nach einer Annahme der Gesetzesänderung, die etwa neu Samenspenden für lesbische Paare vorsieht, könnten die in der Schweiz bislang verbotene Eizellenspende oder die nicht zulässige Leihmutterschaft gefordert werden, befürchten manche.
«Für homosexuelle Paare ist es einfach unmöglich, auf natürliche Weise Nachwuchs zu bekommen. Dieser Unterschied gegenüber Heterosexuellen ist für mich wichtig», betont Ruedi Geiger. Darum möchte er den Ehebegriff ausschliesslich für heterosexuelle Paare verwenden. Sonst würde er verwässern, ist der 79-Jährige überzeugt: «Das Verhältnis Mann-Frau ist etwas ganz Besonderes.»
Gläubig und lesbisch
Anders sehen das die Frauen Eva Kaderli und Sara Folloni. Die beiden kennen sich seit 32 Jahren und sind in derselben Freikirche aufgewachsen. Sie waren beste Freundinnen und haben sich später ineinander verliebt. Diese Liebe durfte aber nicht sein: In der Freikirche, der sie angehörten, war Homosexualität verpönt.
Nach langem Ringen haben sie die Freikirche und das damalige soziale Umfeld verlassen. Vor 24 Jahren war das. Dann, ein paar Jahre später, haben sie sich die beiden verpartnert: Der Kanton Zürich war 2002 der erste Deutschschweizer Kanton, der die eingetragene Partnerschaft zuliess.
Kaderli und Folloni liessen an einem Freitag im Oktober 2003 ihre Partnerschaft eintragen, am Samstag gab es einen Segnungsgottesdienst in der Kirche: «Ich wollte vor vielen Menschen Ja sagen zu Sara», erinnert sich Kaderli, «es war der schönste Tag in meinem Leben.»
Beziehungsvielfalt in der Bibel
Doch das reicht ihnen nicht. Die beiden Frauen wollen heiraten. Dass eine Ehe Mann und Frau vorbehalten sei, weil das etwa schon in der Bibel steht, stört die beiden gläubigen Frauen. «In der Bibel ist etwa auch von Polygamie die Rede, also dass ein Mann mehrere Frauen hat», so Falloni.
Da die Bibel über hunderte von Jahren geschrieben wurde, würde sie die Lebensrealität von all diesen Menschen abbilden, ist sie überzeugt und ergänzt: «Die Bibel zeigt also eine Vielfalt, die wir uns auch wünschen. Ich möchte nicht mehrere Frauen heiraten, bewahre. Aber ich möchte zeigen, dass es in der Bibel weiter und offener ist, als wir denken.»
Die Vorstellung also, dass Mann und Frau heiraten, Kinder bekommen und zusammenbleiben, ist schön und gut. Aber es entspricht nicht mehr der Lebensrealität.
Nicht nur die Bibel sei vielfältiger, auch die Realität. «Heute werden Kinder geboren, die nicht aus einer Ehe stammen. Oder es gibt Ehen, ohne dass daraus Kinder entstehen», erklärt Sara Folloni. «Die Vorstellung also, dass Mann und Frau heiraten, Kinder bekommen und zusammenbleiben, ist schön und gut und kann auch ein Ideal für einige Menschen sein. Aber es entspricht nicht mehr der Lebensrealität.»
Sich verpartnern ist nicht genug
Sara Folloni möchte also heiraten: «Eva ist meine Frau. Es ist nicht meine Partnerin, ich möchte sie heiraten. Ich nehme niemandem etwas weg. Der Slogan ‹Es ist genug Ehe für alle da› passt perfekt und sagt alles», sagt Folloni. Eva Kaderli ergänzt: «Es geht wirklich um die Begrifflichkeit. Und darum, dass meine Beziehung zu Sara, die so ähnlich verläuft wie Beziehungen von Freundinnen zu ihren Männern, vom Staat genauso angesehen wird wie eine heterosexuelle Beziehung.»
Den beiden Frauen geht es ums Prinzip. Mit der eingetragenen Partnerschaft sind sie Ehepaaren zwar in vielen Bereichen nahezu gleichgestellt, etwa im Sozialversicherungsrecht, in Erbschafts- oder Steuerfragen. Dennoch fühlt sich Sara Folloni diskriminiert.
Die Lehrerin und Co-Rektorin der Kantonsschule Wohlen macht ein Beispiel: «Mein Zivilstand ist eine eingetragene Partnerschaft. Wenn meine Partnerin nun sterben würde, wäre mein Zivilstand ‹in aufgelöster Partnerschaft›. Man weiss also nicht, ob ich geschieden oder verwitwet bin. Auf alle Fälle weiss man aber, dass ich lesbisch bin. Das finde ich völlig unnötig.»
Eva Kaderli, Hebamme und Co-Präsidentin des Vereins Regenbogenfamilie, stört sich vor allem an den Nachteilen in Sachen Familie und Kinder. Mit der eingetragenen Partnerschaft dürfen die beiden Frauen kein Kind adoptieren. Derzeit ist einzig die Stiefkindadoption möglich, dass also ein Kind der Partnerin oder des Partners adoptiert wird. «Wir übernehmen Verantwortung füreinander, wir zahlen Steuern. Wir sind in vielem genau gleichgestellt wie Ehepaare – dennoch darf ich kein Kind adoptieren», so Kaderli.
Das Kindeswohl und die sexuelle Präferenz der Eltern
Die Argumente der Gegnerinnen und Gegner, dass Kinder einen Vater und eine Mutter bräuchten, wischt Eva Kaderli vom Tisch: «Seit 40 Jahren gibt es Studien dazu und sie kommen immer zum Schluss, dass es den Kindern gut geht und sie genauso gesunde Erwachsene werden wie Kinder aus herkömmlichen Familien.»
Die Studien (einen Überblick gibt es hier) stammen aus den USA und aus europäischen Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden, wo gleichgeschlechtliche Paare bereits Kinder adoptieren dürfen. Häufig vergleichen die Studien die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von gleichgeschlechtlichen Paaren mit jenen von anders geschlechtlichen Eltern.
Durchgängig stellen die Studien keine Unterschiede in der psychischen oder sozialen Persönlichkeitsentwicklung fest. Daraus wird gefolgert, dass die sexuelle Präferenz der Eltern nicht über das Kindeswohl entscheidet. Es sei vielmehr das Klima in den Familien und wie die konkreten Beziehungen gelebt werden.
Braucht ein Kind Vater und Mutter?
Das überzeugt Ruedi Geiger nicht: «Vielleicht sind solche Studien nicht wertfrei. Man hatte sicher immer schon eine Absicht, wie eine Studie rauskommen soll. Ich denke, ab jetzt kann man viel objektiver forschen», sagt der promovierte Naturwissenschaftler und ergänzt selbstkritisch: «Aber vielleicht weiss ich auch zu wenig darüber.»
Ich plädiere dafür, mit den Gesetzesänderungen noch zuzuwarten und andere Lösungen zu finden.
Ruedi Geiger betont im Gespräch immer wieder, dass es punkto Regenbogenfamilien an Erfahrung fehlen würden: «In 20 Jahren wissen wir mehr. Darum plädiere ich dafür, mit den Gesetzesänderungen noch zuzuwarten und andere Lösungen zu finden». Diese dürften jedoch nicht zum Nachteil der Kinder sein.
Das Kindeswohl bringen Gegnerinnen und Gegner am Konzept der Ehe immer wieder an. Es sei wichtig, dass Kinder einen Vater und eine Mutter hätten und im Idealfall in der Ursprungsfamilie verwurzelt seien. Dass etwa Kinder, die mit Hilfe einer Samenspende zur Welt kommen, erst mit 18 Jahren den biologischen Vater kennenlernen dürfen, finden viele zu spät.
«Allzu schnell werden wir in diese Ecke gestellt»
Ruedi Geiger ist selbst verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Es ist ihm ein Anliegen zu zeigen, dass Gegnerinnen und Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht hinterwäldlerisch oder politisch und religiös extrem seien. «Allzu schnell werden wir in diese Ecke gestellt», stört sich der Chemiker.
Politisch gesehen sei er «ein Mensch der Mitte, mit einem grünen Herz». Persönliche Freiheiten und Meinungsfreiheit seien ihm wichtig, «deshalb bezeichne ich mich als liberal.» Entsprechend wählt und stimmt er oft für die FDP, ausser wenn es um die «Ehe für alle» geht.
Die FDP hatte im Sommer die Ja-Parole gefasst, Geiger folgt nun aber der SVP und ihrem Nein. Aber: «Bei der SVP grenze ich mich häufig auch ab. Ich bin gegen ihre fremdenfeindliche Politik.»
Auch Religion spielt für den Reformierten eine Rolle. Regelmässig in die Kirche gehe er nicht, «aber ich bete oft und denke immer daran, dass da noch etwas ist.» Zudem fühlt er sich dem gesellschaftlichen Funktionieren verpflichtet: «Wenn ich Probleme sehe, muss ich etwas unternehmen. Wenn ich nichts tue, könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen», sagt Geiger.
Das führe manchmal auch zu Problemen: «Meine Frau ist da sehr kritisch. Sie findet, ich solle lieber im Garten arbeiten oder mein Zimmer aufräumen.» Rund um die «Ehe für alle» hat er das Referendum unterstützt oder schreibt Leserbriefe, die in der NZZ oder Basler Zeitung abgedruckt werden.
Ist die Ehe für alle wirklich ein Bedürfnis?
Im näheren Umfeld hat Ruedi Geiger kaum Kontakt mit schwulen oder lesbischen Paaren. Und bei denen, die er kenne, wolle niemand heiraten. «Darum frage ich mich: Ist die Ehe für alle wirklich ein Bedürfnis?» Im Verhältnis seien es ja auch nur wenige homosexuelle Gemeinschaften verglichen mit Heterosexuellen. «Aber man darf jetzt nicht einfach mit der Mehrheit argumentieren. Das ist auch nicht demokratisch», gibt er zu bedenken.
Demokratisch ist immerhin, dass die Ehe für alle im September zur Abstimmung kommt. Für Ruedi Geiger ist klar, dass er Nein stimmen wird. Die beiden Frauen Eva Kaderli und Sara Folloni hoffen hingegen auf ein Ja. Dann, so viel steht fest, würde geheiratet im Hause Kaderli-Folloni.