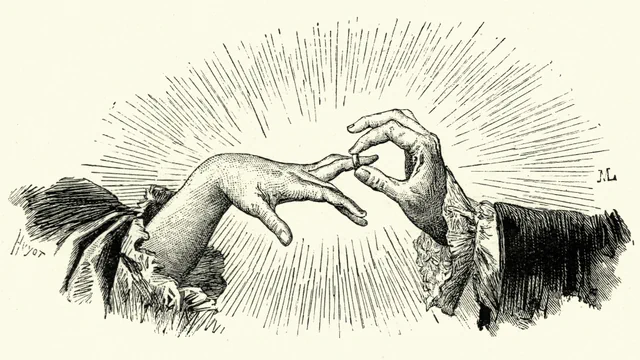Einmal Sex und schon verheiratet: So könnte man die Ehe im Mittelalter zusammenfassen. Seit 1215 galt diese Regel, sie war ein Fortschritt für Brautleute.
Zuvor hatten die Eltern alles geregelt, mit den neuen Bestimmungen konnten die Brautleute sich gegenseitig die Ehe versprechen – und das galt. Wenn dieses Versprechen dann noch mit Geschlechtsverkehr besiegelt wurde, umso besser. Eltern, Zeugen oder einen Priester brauchte es nicht.
Ist das noch Sex oder schon Ehe?
«Das war eine Befreiung und ein ganz wichtiger Schritt in Richtung der Individualisierung junger Leute», sagt Susanna Burghartz, Geschichtsprofessorin an der Universität Basel.
Allerdings waren die neuen Regeln auch nicht unproblematisch: «Es gab ständig Auseinandersetzung, ob der Geschlechtsverkehr wirklich eine Eheschliessung war oder einfach nur Sex.»
Den Trieb zähmen
300 Jahre später veränderte die Reformation die Ehe grundlegend. Die Reformatoren sahen die Ehe als Mittel, um die Sexualität in Zaum zu halten. Eine Sexualität, die sie als menschlichen Urtrieb ansahen, der unkontrollierbar und deshalb gefährlich war für die Gesellschaft.
«Sexualität ausserhalb der Ehe galt als Unzucht und musste verfolgt werden. Unehelicher Sex und uneheliche Kinder wurden kriminalisiert», erklärt Historikerin Susanna Burghartz. Und im Zuge dieser Kriminalisierung ausserehelicher Sexualität wurde auch Homosexualität immer stärker verfolgt und bestraft.
Der Staat macht mit
Die Reformatoren schufen Ehegerichte. Um zu heiraten, brauchte es neu einen Pfarrer und zwei Zeugen. Die Reformatoren führten die Scheidung ein, denn in der reformierten Kirche war die Ehe kein Sakrament mehr. Und sie holten den Staat an Bord und legten damit die Grundlage für die heutigen Standesämter und die Zivilehe.
Auch über die Liebe machten sie sich Gedanken. Sie waren der Meinung, dass die Liebe in der Ehe entstehe.
Aus dem Archiv: Die Schweiz diskutiert 1988 über ein neues Eherecht
Wie die Liebe in die Ehe kam
Das änderte sich im 18. Jahrhundert – in der Zeit der Romantik. «Die Liebe wurde damals zur Voraussetzung für eine Ehe», sagt Burghartz. Damit veränderte sich im Laufe der Zeit der Zweck der Ehe: «Die Ehe wurde von einer wirtschaftlichen Gemeinschaft, die das Überleben der Familie garantiert, zu einem Ort für intime, emotionale Beziehungen.»
Als die Pille eine sichere Verhütung ermöglichte, wurden Ehe und Sexualität entkoppelt. Ein neues Erbrecht führte dazu, dass aussereheliche Kinder dieselben Rechte haben wie ehelich. Kürzlich sagte das Parlament Ja zur Ehe für schwule und lesbische Paare.
Wie geht es weiter?
Das dürfte nicht das letzte Kapitel in der Geschichte der Ehe sein. «Wir müssen diskutieren, wie auch diejenigen Menschen einen Platz finden in unserer Gesellschaft, die anders leben möchten», sagt die römisch-katholische Theologin Susanne Andrea Birke.
Sie denke an schwule und lesbische Paare, die gemeinsam Kinder haben. An Menschen, die zusammen Kinder aufziehen, ohne ein Paar zu sein. An Paare, die ihre Kinder in einer Gemeinschaft aufziehen möchten. «Wir müssen auch diese alternativen Beziehungen schützen», betont Susanne Andrea Birke.
Die Kirchen könnten hier mit gutem Beispiel vorausgehen und Rituale anbieten, etwa Segnungsfeiern für Patchwork-Familien. «Hier gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wir müssen sie nur nutzen.»