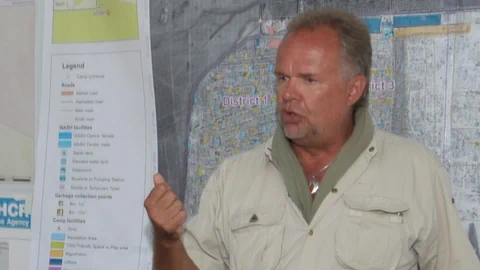Kilian Kleinschmidt, was haben Sie in Zaatari gelernt?
Zunächst einmal, dass wir nicht davon ausgehen können, dass der Mensch in der Krise uneigennützig und solidarisch handelt. Das tut er nicht, er denkt und handelt für sich selber. Dann haben wir gedacht: Das sind alles Syrer, die sind eine Gemeinschaft, kennen sich und helfen einander – auch falsch. Aber das Wichtigste, das wir gelernt haben, ist, dass es nicht reicht, einfach Kalorien in den Mund zu stopfen, ein Zeltdach über den Kopf zu stellen und 18 Liter Wasser zur Verfügung zu stellen. Das macht den Menschen nicht aus. Der Mensch ist ein komplexes Wesen. Dieses Wesen braucht eben die Akzeptanz der Menschlichkeit, auch eine Diversität, und das Recht, ein Individuum zu sein.
Wir machen in diesen Situationen den Menschen zur Massenware. Er wird nur noch als ein logistisches Problem angesehen. Die Debatte in Europa ist im Moment ähnlich.
Was heisst das?
Es geht natürlich erstmal um die Frage: Wie bringen wir eine Million Menschen in Europa unter? Logistisch sollte das zu schaffen sein, mit dem Geld und den Möglichkeiten, die wir hier haben. Aber dann stellt sich ganz schnell die Frage: Wie schaffen wir es, diese Menschen aus der anonymen Masse herauszuholen, wieder Regeln und Strukturen reinzubringen?
Wie meinen Sie das?
Als ich in Zaatari das Lager übernahm, waren auch keine Gesellschaftsstrukturen vorhanden. Es gab Banden, Ganoven, mafiöse Organisationen und vor allem waren die Kinder völlig ausser Rand und Band.
Ich schockiere die Menschen immer wieder, wenn ich die Vorkommnisse in Köln während der Silvesternacht mit den Kindern von Zaatari vergleiche. Mit Kindern, denen niemand gesagt hat: Das tut man nicht, Steine auf Hilfsorganisationen zu werfen. Darum haben sie fröhlich weitergemacht. Die Kinder waren denn auch für uns von der Lagerleitung die gefährlichsten Gegner. Wir sind vor diesen Kinderhorden wie die Kaninchen weggerannt. Die Erwachsenen haben gelacht und die Kinder nicht zur Ordnung gerufen.
So ähnlich würde es uns gehen, wenn wir keine Struktur mehr hätten wie etwa in einer Bürgerkriegssituation, auch wir brächen dann aus. Das merken wir in Massensituationen, in Panik, wenn wir nicht mehr aufeinander aufpassen – das ist in Köln passiert, das ist in Zaatari passiert.
Also nicht einfach nur eine Willkommenskultur, sondern mehr. Was brauchen Flüchtlinge denn, wenn sie ankommen?
Sie brauchen eine Ankommenskultur, sie brauchen die Gewissheit, dass sie irgendwo angekommen sind. Das war in Zaatari nicht anders. Wir hatten jeden Tag Massendemonstrationen, Gewalt, gar nicht so weit entfernt von dem, was wir in Flüchtlingsunterkünften erleben. Da ging es zunächst einmal darum, zu ergründen, was den Menschen denn fehlt, dass sie so aggressiv und desorientiert sind. Das können ja nicht die fehlenden Kalorien sein oder das fehlende Wasser. Von beidem gab es genug. Es war vielmehr ein Aufruhr gegen die eigene Machtlosigkeit. Dieses Gefühl, nicht mehr selbständig entscheiden zu können.
Wie sind Sie da vorgegangen?
Wir haben versucht, durch viel Dialog die wichtigen Probleme herauszukristallisieren – viel Kaffee trinken, viel Tee trinken, um herauszufinden, was die Menschen wirklich brauchen. Ich habe mich hingesetzt, auch nach der Arbeitszeit, habe mit den Menschen geredet oder einfach nur beobachtet. Dann haben wir begonnen, all die Aufrührer und Bandenchefs zu isolieren. Gleichzeitig haben wir endlich realistische Zahlen gekriegt, haben in die Infrastruktur investiert und den Menschen reale Entscheidungsmöglichkeiten gegeben, indem wir ihnen zum Beispiel einen Supermarkt zur Verfügung gestellt haben. Dagegen haben die Bandenchefs rebelliert, aber umsonst. Es kam keiner mehr hin zu den Demos.
Beiträge zum Thema
Und wenn wir das nun nochmals auf die Silvesternacht in Köln beziehen – was können wir von Zaatari lernen?
Man muss anerkennen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die diese Strukturen nicht mehr haben, egal ob sie in einem Durchgangsheim, einem Asylbewerberheim oder sonstwo leben. Entscheidend ist, dass sie noch nicht in gesellschaftlichen Strukturen angekommen sind. Es gibt in diesen Kreisen keine wirklichen Autoritäten.
Nun muss es darum gehen, die zerstörerischen, negativen Ansätze und die Menschen, die sich als Bandenchefs aufspielen, durch positive Strukturen zu ersetzen. Das heisst aber auch, dass man sich die Möglichkeiten und Mittel gibt, sich positiv mit den Menschen auseinanderzusetzen, sie auch zu erkennen und nicht nur über die Versorgung nachzudenken. Den Menschen also zuzuhören und zu fragen: Was steckt hinter dieser oberflächlichen Aggressivität?