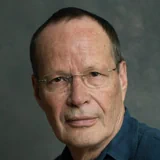Kunsang Wangmo – genannt Mola – lebte 45 Jahre im Exil und hatte am Ende ihres Lebens den Wunsch, ihre Heimat Tibet wiederzusehen. Regisseurin Yangzom Brauen und ihr Vater, der Regisseur Martin Brauen, sprechen über ihren Film, der das bewegende Leben Molas begleitet.
SRF: Was war Ihre Motivation, einen so persönlichen Dokfilm über Mola – Ihre Schwieger- und Grossmutter – zu drehen?
Yangzom Brauen: Mola hätte nie gedacht, dass jemand einen Film über sie drehen will. Für mich war ihre Lebensweise jedoch etwas Besonderes. Sie ist in einer Welt aufgewachsen, die verschwindet – mit einer Kultur und Ritualen, die bald nicht mehr existieren werden. Ich wollte ein Zeugnis für die ältere, aus Tibet geflüchtete Generation schaffen.
Martin Brauen: Ich war fasziniert von ihrem spirituellen Alltag. Und es gibt kaum Filme über tibetische Nonnen. Während der Dreharbeiten teilte Mola uns überraschend mit, dass sie in Tibet sterben möchte, nahe dem «reinen Land», wo sie das buddhistische Paradies vermutete. Das gab dem Film eine ganz neue Wendung.
Der Wunsch nach einer Rückkehr in eine Heimat, die immer unzugänglich geblieben ist?
Yangzom: Ja. Mola floh 1959 aus Tibet nach Indien und kam später in die Schweiz. Sie hat immer gehofft, dass ihre Heimat eines Tages frei sein würde. Deshalb schaute sie jeden Abend die «Tagesschau».
Der Glaube war für Mola unantastbar.
Martin: Für die letzte Reise dauerte es über ein Jahr, bis die chinesischen Behörden das Visum bewilligten. Mola sprach von der Schweiz als Paradies. Offensichtlich aber gab es für sie zwei Arten von Paradiesen: eines, in dem man Erlösung findet.
Wie war es, die eigene Familie über so lange Zeit zu filmen?
Yangzom: Wir hatten keine Filmcrew. Martin filmte, ich gab Feedback aus L.A.. Über Weihnachten war ich in Bern, habe selbst gefilmt und den Ton kontrolliert. Es war ein langer Prozess: fünf Jahre Dreharbeiten, dann kam Covid, erst danach der Schnitt. Wenn ich in der Schweiz war, habe ich bei ihr im Zimmer auf einer Matratze übernachtet. Morgens um vier Uhr bin ich mit ihr aufgestanden, um sie bei ihren Ritualen zu filmen. Solche intimen Szenen waren nur möglich, weil sie uns vertraute. Mola ist 2019 gestorben, kurz vor der Fertigstellung.
Es ist beeindruckend zu sehen, welch gelassenes Verhältnis Mola zum Tod hatte. Welche Rolle spielte hierbei ihr Glaube?
Yangzom: Der Glaube war für Mola unantastbar. Zum Beten gehörte eine eiserne Disziplin: drei Stunden am Morgen, zwei am Nachmittag. Das war ihr Anker – selbst im Spital.
Dank ihres Glaubens hegte sie keinen Groll.
Martin: Mola lebte in einem anderen Denkuniversum. Im buddhistischen Glauben ist das gesamte Leben eine Vorbereitung auf den Tod. Sie hat sich vorbereitet – strukturiert durch Rituale, getragen vom Glauben an das Karma.
Warum Karma?
Martin: Karma ist das Gesetz der wirkenden Tat. Was man tut und denkt, bestimmt die Zukunft. Mola hat schwere Schicksalsschläge erlebt: Sie hat jung ein Kind und ihren Mann verloren, musste aus Tibet flüchten. Doch dank ihres Glaubens hegte sie keinen Groll. Sie hoffte auf eine gute Wiedergeburt oder das Paradies. Der Weg dorthin, so schmerzhaft er war, spielte kaum eine Rolle.
Was sollen die Zuschauenden aus dem Film mitnehmen?
Yangzom: Mola konnte vollkommen in der Gegenwart sein, den Moment geniessen. Sie nahm vieles mit Humor, lachte so gern, wie sie Schabernack trieb.
Martin: Mola war eine Frau, die sich nicht um Konventionen kümmerte. Susan Sontag schrieb: «Frauen sollten es ihren Gesichtern erlauben, das Leben, das sie führten, zu zeigen.» Mola hat das gelebt – hingebungsvoll, charismatisch und voller Liebe.
Das Gespräch führte Nina Weiss.