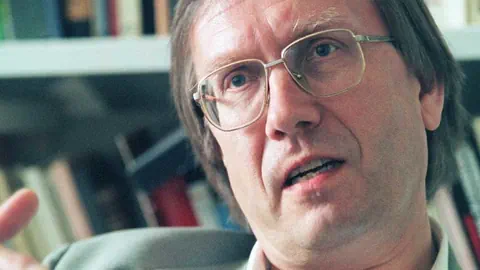SRF: Markus Zangger beschreibt in seinem Buch die jahrelange sexuelle Gewalt, die sein Lehrer ausübte. Sind seine Schilderungen typisch für Missbrauchsopfer?
Jürgen Oelkers: Wie allen Missbrauchsopfern fällt es auch Zangger schwer, über die Vorkommnisse zu sprechen. Das war bei den ehemaligen Schülern der Odenwaldschule zu beobachten und nun auch in Zanggers Buch. Liest man seine Beschreibungen, sind auch ähnliche Strategien und Mechanismen zu beobachten.
Der Missbrauch findet an einem entlegenen Ort statt, ein Auto spielt eine Rolle, Fahrten mit dem Lehrer – in der Odenwaldschule war der Bäckerbus der Tatort. Die Versuche der Täter gehen dahin, die emotionalen Abhängigkeiten möglichst schleichend aufzubauen und dann das Machtgefälle steil hochzufahren.
Was ist anders am Fall von Zangger?
Die Selbsternennung des Täters Jegge zum Therapeuten. Das war an der Odenwaldschule nicht so. Die Pädagogen haben dort zwar die Kinder in die Therapie geschickt, aber haben sich nicht selber als Therapeut aufgespielt.
Auffällig an Jegges Fall ist, dass er sich nicht nur als Therapeuten bezeichnet, sondern das Ganze auch Therapie nennt. Auch Jahre später noch, er erklärte sogar, woher die Therapie stammt: vom Psychoanalytiker und Marxisten Wilhelm Reich.
Was hat Reich propagiert?
Dass Sexualität eine Art Lebensenergie ist, die fliesst. Blockiert man diese, blockiert man auch die Psyche. Darum sollte diese Energie freigesetzt werden, damit auch die Psyche frei sei. Die Kausalfaktoren waren vor allem die bürgerliche Kleinfamilie und die Schule. Wenn man die Kinder von beiden befreie, würden Charakter und Persönlichkeit der Kinder befreit. Das nannte Reich Charakteranalyse. Die Blockaden waren sogenannte Charakter-Panzer.
Heisst das, Jegge ist fein raus, wenn er sich auf den Zeitgeist beruft?
Nein. Er ist ein Täter. Ein Täter verschafft sich Ideologien und Legitimationen, um seine Taten auszuüben. Da kamen Willem Reichs Thesen gerade Recht.
Der Fall Jegge: Die Vorgeschichte
Warum ist der Missbrauch all die Jahre niemandem aufgefallen?
Mittlerweile wurde eine Weisung an Jegge gefunden. Sie wurde 1973 ausgestellt. Da steht drin: Es ist ihm untersagt, die Kinder in seine Wohnung zu nehmen, und auch mit den Kindern im Auto zu fahren. Es deutet darauf hin, dass man eine Vorstellung hatte, was los war. Eine Weisung muss man aber auch kontrollieren, und weitere Akten gibt es nicht. Wenn es aber eine Weisung gibt, dann gibt es auch einen Vorfall.
Sprechen wir über den pädagogischen Eros: Viele verstehen darunter eine förderliche Nähe zwischen Schüler und Lehrer. Was ist genau unter diesem Begriff zu verstehen?
Der Begriff stammt aus der Antike. Er meint die Abhängigkeit eines Knaben von einem älteren Erwachsenen. Abhängigkeit hiess in der Antike fast immer sexuelle Abhängigkeit. In den 1920er-Jahren kam dieser Begriff wieder auf, man sprach vom pädagogischen Bezug, wo Nähe eine wichtige Rolle spielte. Damit war nie die erotisierte oder sexualisierte Nähe gemeint, das haben aber Pädophile unter dem Begriff verstanden. Der Zugang zum Kind war: Ich tue dem Kind Gutes, wenn ich ihm ganz nahe bin. Und das ist gleichzeitig die Täter-Ideologie.
Heute ist klar: Es gibt keine förderliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern. Das redete man sich in den 1970er-Jahren ein. Damals gab es eine grosse Pädophilenbewegung, die mit pseudo-wissenschaftlichen Daten ankam. Aber die gibt es definitiv nicht mehr.
Die «Weltwoche» nannte Jegge letztes Jahr noch «Lehrer der Nation» und verlieh ihm einen Preis, den er entgegennahm. Wie steht es mit dem Unrechtsbewusstsein der Täter?
Diese Art von Täter hat kein Unrechtsbewusstsein. Es liegt lange zurück und wird relativiert. Er schreibt in seinem Brief an Zangger auch «wenn es geschadet hat...» – dieses konditionale Reden bedeutet, dass man dem Opfer unterstellt, dass es nicht geschadet haben muss.
Am 27. Mai 2015 reagierte Jegge mit einem Brief auf Zangger. Dazwischen gibt es 30 Jahre Fachliteratur über die Schädigung durch sexuelle Gewalt an Kindern. Kann das an Jegge vorbeigegangen sein?
Das kann. Vor allem dann, wenn man sich einer Sache sicher ist.
Das Gespräch führte Cornelia Kazis.
Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Kontext, 10.04.2017, 9:00 Uhr