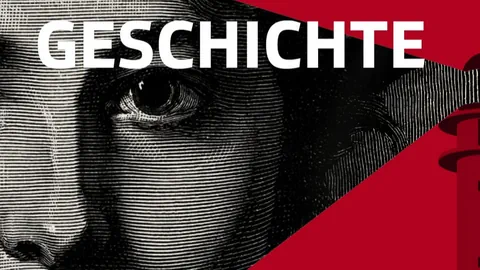Gorana Kusic kann sich noch gut an ihre Rückkehr nach Vukovar erinnern: «Es war ein Schock.» Alles sei kaputt gewesen. Sie war damals ein Teenager. Den Krieg verbrachte sie als Kind mit ihrer Familie in Deutschland.
Die Schule besuchte Gorana Kusic mit den anderen kroatischen Kindern, deren Eltern nach dem Krieg zurückgekehrt waren. Die serbischen Kinder hatten im unteren Stockwerk Unterricht.
Das sei damals, nur kurz nach dem Krieg, wohl eine gute Lösung gewesen. «Leider haben wir aber noch immer getrennte Schulen», sagt Gorana Kusic. Der separate Unterricht ist das deutlichste Symbol dafür, dass die Trennung zwischen den Volksgruppen weiterhin politisch gewollt ist.
Dank der friedlichen Reintegration konnten Tausende Menschenleben gerettet werden, wie Dijana Antunovic Lazic sagt. Schon nur deshalb sei sie ein Erfolg. Sie leitet die Organisation «Evropski Dom Vukovar», die sich seit kurz nach Kriegsende für die Versöhnung einsetzt. Das Zusammenleben in der Stadt sei in den letzten Jahren viel besser geworden.
Gerade die junge Generation mache ihr Hoffnung. Trotz getrennter Schulen sei das Zusammenleben für sie selbstverständlich. Doch manche der älteren Generation könnten sich nicht von der Vergangenheit lösen, sagt Dijana Antunovic Lazic. Dies sei verständlich, es sei schwierig, loszulassen, wenn man im Krieg Angehörige verloren hat.
Vukovar wird instrumentalisiert
Vukovar hat in Kroatien Heldenstatus. Jedes Schulkind besucht die Stadt an der Grenze zu Serbien. Jedes Jahr gedenkt das Land jenem Tag, als die Stadt von den serbischen Truppen eingenommen wurde.
-
Bild 1 von 6. Jeweils am 18. November wird dem Fall der Stadt gedacht. Es ist ein nationaler Feiertag. Bild von 2021. Bildquelle: REUTERS/Antonio Bronic.
-
Bild 2 von 6. Nach 87 Tagen Belagerung lag Vukovar in Trümmern. Im Bild: Bewohner sammeln am 28. November 1991 ihre Habseligkeiten zusammen. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Patric Andric.
-
Bild 3 von 6. Auch heute noch sind die Spuren der Vergangenheit in Vukovar zu finden. Aufnahme vom 30. Gedenktag an den Fall der Stadt am 18. November 2021. Bildquelle: Reuters/Antonio Bronic.
-
Bild 4 von 6. Der Wasserturm von Vukovar wurde im Krieg von über 600 Geschossen getroffen. Aufnahme vom März 1992. Bildquelle: Getty Images/Francoise De Mulder/Roger Viollet.
-
Bild 5 von 6. Heute ist der Wasserturm mit seinen Einschusslöchern ein Mahnmal und ein Symbol für die Stadt. Er ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Bildquelle: IMAGO/Xinhua.
-
Bild 6 von 6. Der ikonische Wasserturm sticht im Stadtpanorama von Vukovar hervor. Bildquelle: SRF/Janis Fahrländer.
Dies habe auch eine problematische Seite, findet Dijana Antunovic Lazic. «Militärische Erfolge erhalten viel mehr Aufmerksamkeit als die friedliche Reintegration.»
Vukovar werde zudem von der Politik auf lokaler, aber auch auf nationaler Ebene instrumentalisiert. Dies nutze die Stadt für ihre eigenen Zwecke, um eine nationalistische Agenda zu betreiben, statt das funktionierende Zusammenleben zu fördern.
Auch Gorana Kusic bedauert den ständigen Fokus auf den Krieg statt aufs Miteinander im Hier und Jetzt. Einmal im Jahr reise die Prominenz aus Zagreb für die Gedenkveranstaltung an, interessiere sich aber den Rest des Jahres kaum für den Alltag in der Stadt. «Für mich ist das Leben in Vukovar 365 Tage im Jahr und nicht nur an einem Tag wie für die anderen.» Die Stadt brauche keine Delegationen, sondern Ideen, wie man besser zusammenleben kann.
Doch statt solche Ideen zu fördern, halte ein Grossteil der Politik lieber am Symbol Vukovar fest. An der Heldenstadt, die vor über 30 Jahren im Krieg zerstört wurde. Dabei ist die Erinnerung auch für Gorana Kusic wichtig. Doch für sie ist Vukovar nicht nur ein Symbol, sondern der Ort, an dem sie lebt.