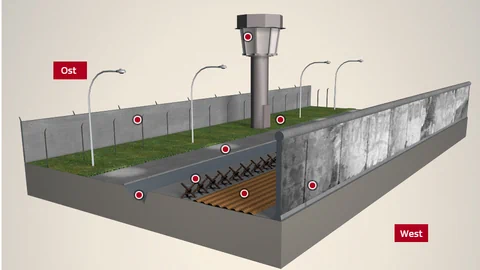«Ich bin aufgewachsen in Markleeberg, einer Kleinstadt am südlichen Stadtrand von Leipzig. Ich habe dort eine wunderschöne Kindheit verlebt. Wir wohnten im Erdgeschoss eines grossen, alten Hauses mit Garten. Früher gehörte das einem reichen Schokoladenfabrikanten. Nach dem Krieg wurde er enteignet, das Haus fiel ins Volkseigentum und wurde vermietet. Es war wie viele andere über die Jahre dem Zerfall preisgegeben. Aber wir hatten es schön dort.
Meine Eltern haben beide in der DDR studiert – meine Mutter Journalismus, mein Vater Agrarwissenschaften. Ich würde uns als sehr angepasst bezeichnen, meine Mutter noch stärker als meinen Vater. Beide waren in der Partei.
Meine Mutter war aus tiefer Überzeugung Mitglied geworden und sagt heute von sich, dass sie damals nur sehr wenige Dinge hinterfragt hat. Sie arbeitete als stellvertretende Bürgermeisterin im Rathaus von Markleeberg und hat sich unglaublich aufgeopfert für den Staat.
Anders mein Vater. Er arbeitete in Markleeberg bei der Agra, das war die Landwirtschaftsausstellung der DDR. Er war weitaus kritischer und hatte auch immer mal wieder ein Parteiverfahren am Hals. Worum es genau ging, weiss ich nicht. Er ist vor einigen Jahren gestorben, deshalb kann ich ihn leider nicht mehr fragen.
Ich weiss aber, dass meine Eltern mit ihren Ansichten ganz oft aneinander gerieten – gerade in der Wendezeit. Mir bleibt aus dieser Zeit deshalb auch ganz stark die Erinnerung daran, wie unterschiedlich meine Eltern mit den Veränderungen umgingen.
Mit einem Kniff auf die Oberschule
Die Wendezeit fiel bei mir zusammen mit dem Wechsel in eine neue Schule. Ich wollte gern Abitur machen und in meiner alten Schule wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Als Kind von zwei Akademikern hatte ich im Arbeiter- und Bauernstaat von vorneherein schlechte Karten. Zudem hatten sich in meiner Klasse schon mehrere Schulkameraden zur Nationalen Volksarmee gemeldet – die wenigen Plätze waren damit vergeben, zumindest erinnere ich mich so daran.
Über einen Kniff kam ich dann aber doch noch auf die Oberschule. In Markleeberg gab es eine Musikschule, an der man auch das Abitur machen konnte. Ich spielte damals Klavier und habe mich wirklich ein Jahr lang auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Es klappte und die neue Schule fing nach den Sommerferien 1989 an.
In diesem Sommer haben wir schon ganz deutlich gespürt, dass sich im Land etwas bewegte. Als ich aus den Ferien zurück kam, hörten wir als erstes, dass in Ungarn die Grenzen offen seien. Mich hat das zunächst nicht wirklich beschäftigt – bis zu dem Zeitpunkt, als der Sohn unserer Nachbarn, der war damals 19, nicht aus Ungarn zurückkam. Der war abgehauen. Ganz allein. Das gab natürlich ein Riesengerede, auch in meiner Familie. Meine Mutter hat das nicht verstanden, mein Vater schon.
Der gehässige Ton
In Erinnerung geblieben ist mir auch der extrem gehässige Ton aus dieser Zeit. Unser Klassenlehrer in der neuen Schule stand zum Beispiel am ersten Schultag vor uns stand und schimpfte auf die ‹Verräter›, die das Land verlassen hätten und denen niemand eine Träne nachweine. Genau so klang das ja auch im DDR-Fernsehen.
Am 7. Oktober war dann der 40. Jahrestag der DDR. Schon in den Wochen zuvor waren in Leipzig immer mehr Menschen zu den Montagsdemonstrationen gekommen. Das heisst, es war klar, dass es nicht einfach so sein würde wie in den Jahren zuvor.
Ich weiss noch, dass mein Vater an diesem Tag in unserem Kleingarten zugange war, der gleich hinter dem Gelände der Landwirtschaftsausstellung lag. Er kam an diesem Abend nach Hause und sagte zu meiner Mutter: Da passiert etwas. Die haben bei den Ställen Leute aus der Innenstadt abgeladen. Ich erinnere mich daran, dass die beiden sich in der Küche darüber gestritten haben. Meine Mutter beharrte damals darauf, dass das nicht sein könne.
Kritisch wurde es dann am Montag drauf. An diesem 9. Oktober (siehe Box) waren sowohl mein Vater als auch mein Schwager in der Leipziger Innenstadt. Ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass die beiden dort zusammen gewesen sein müssen.
Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass mein Vater an diesem Abend von der Kampfgruppe eingezogen wurde (Kampfgruppen waren das ‹bewaffnete Organ der Arbeiterklasse›. Die Milizen gab es in jedem grösseren DDR-Betrieb, sie rekrutierten sich aus den Beschäftigten – Anm. der Red.)
Ich bedaure sehr, dass ich meinen Vater heute nicht mehr selbst über diesen Abend befragen kann. Ich weiss aber, dass ihn diese ganze Wendezeit sehr aufgewühlt hat. Er hat extrem auf Veränderungen hingefiebert. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die anfangs in eine Art Starre fiel und ihr ganzes bisheriges Leben hinterfragte.
Mein Schwager erzählte uns später, wie sehr ihn die Menschenmenge an diesem 9. Oktober bewegt hat. Und dass er wirklich auch Angst hatte – immerhin sassen zu Hause sein Frau und zwei Kinder. Mein Schwager ist ein sehr geradliniger Mensch, der auch in der DDR für ehrliche Arbeit stand und sich immer dafür einsetzte, dass man umgekehrt auch ein paar Rechte und Freiheiten bekommt. Ihn hat es umgetrieben, dass das ganze Leben in der DDR über Beziehungen lief und Kritik gar nie zugelassen wurde. Ich glaube, für ihn war es in diesen Wochen toll zu sehen, dass es noch andere gab, die genau so dachten wie er.
Der Tag nach dem Mauerfall
Mit dem Mauerfall hat zu dem Zeitpunkt von uns aber niemand gerechnet. Ich denke, dass hat wirklich alle überrascht. Wie ich am 9. November genau davon erfuhr, weiss ich heute nicht mehr. Ich erinnere mich aber noch, dass ich am 10. November in die Schule ging – und da nur noch vier andere waren. Die meisten waren in Berlin oder standen in der Schlange fürs Visum.
Wir sind erst Anfang Dezember das erste Mal im Westen gewesen. Meine Mutter stammt ursprünglich aus dem Grenzgebiet in Thüringen. Als die Grenze errichtet wurde, wurde ihre Familie getrennt. Ihre Cousins und Cousinen lebten auf der anderen Seite. Sie haben wir dann als erstes besucht. Ich weiss noch, wie ehrlich die Freude war, als die sich alle in die Arme fielen. Das Schöne ist, dass die Familie nach der Wende auch wieder ganz stark zusammengewachsen sind.
Das erste Mal im Westen
An den ersten Besuch drüben habe ich zwiespältige Erinnerungen. Einerseits war ich neugierig und staunte über diese Glitzerwelt. Andererseits war mir das alles auch unangenehm. Dass man sich dort dieses Begrüssungsgeld abholte und auch die Verwandten mir Geld in die Hand drückten. Mich hat das überfordert.
Wir wurden dann ziemlich schnell mit dem Schulchor auch zu Auftritten nach Westdeutschland eingeladen. Einmal, das weiss ich noch, war ich auf einer solchen Reise bei einer Pfarrersfamilie untergebracht. Die Frau sagte irgendwann tatsächlich zu mir, sie wundere sich sehr, wie gut ich Deutsch spreche. Also bitte? Die war davon ausgegangen, dass wir polnisch sprechen.
Das war rückblickend eine sehr schöne Zeit. Damals ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, dass es jetzt normal ist, reisen zu dürfen. Die Tragweite der Ereignisse hat sich mir aber trotzdem erst viel, viel später erschlossen.
Nach der Schule habe ich Jura studiert. Ich hätte mir damals auch vorstellen können, Logopädin oder Musiktherapeutin zu werden. Am Ende war es aber mein Vater, der mich in eine andere Richtung lenkte. Der hatte wohl das Gefühl, ich müsste aus all den neuen Möglichkeiten nun auch das Richtige machen. Jedenfalls hatte er mich heimlich für ein Jura-Studium angemeldet. Und am Ende habe ich mich dann wirklich weichklopfen lassen. Und so kam ich zu meinem Studium – erst in Leipzig, später ging ich noch ein Jahr nach Frankreich.
Dort habe ich auch meinen heutigen Mann kennengelernt – einen Schweizer. Das war zwar weniger gut für meine Französischkenntnisse, für mein weiteres Leben aber schon. Seit 2004 leben wir zusammen in Zürich und haben inzwischen einen Sohn.
«Zürich hat mich verändert»
Fühle ich mich noch ostdeutsch? Ich lebe sehr gern hier in Zürich, das muss ich vorausschicken. Ich liebe meine Familie, ich habe einen interessanten Job und einen Freundeskreis, der fast ausschliesslich aus Schweizern besteht. Ich fühle mich wirklich gut integriert hier und bin inzwischen auch eingebürgert. Aber: Leipzig wird immer meine Heimat bleiben. Vielleicht ist es diese andere Mentalität der Menschen, die ich immer sofort spüre, wenn ich dort bin. Manchmal habe ich das Gefühl, dass das Leben dort trotz vieler Widrigkeiten unbeschwerter ist. Vielleicht, weil es ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl gibt? Es könnte aber auch sein, dass ich das etwas verkläre.
Ich merke aber, dass mich Zürich verändert hat. Ich nehme mich hier zurück – vielleicht, weil ich das Gefühl habe, mich anpassen zu wollen. Und wer weiss, vielleicht ist das ja auch typisch ostdeutsch? Vielleicht können wir das ja besonders gut? Vielleicht nehmen wir uns aber auch einfach weniger wichtig.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich sicher privilegiert bin. Ich war damals alt genug, um die DDR miterlebt zu haben, und jung genug, um die Fatalitäten des Systems nicht am eigenen Leibe spüren zu müssen.»