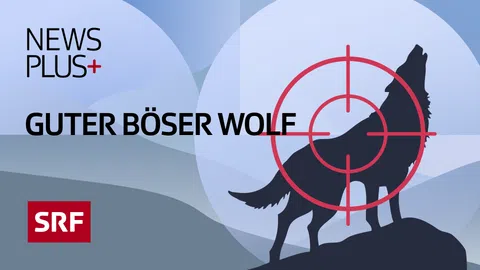Michael Baggenstoss steht in Gummistiefeln auf seiner Schafweide nahe Payerne im Kanton Waadt. Der ehemalige Präsident der Schweizer Berufsschäferinnen und – schäfer lebt von der Schafhaltung – Jahr für Jahr sömmert er rund 700 Schafe auf einer Alp im Misox, wo es auch Wölfe hat. In den letzten Sommern hätten sie seine Tiere dort zum Glück in Ruhe gelassen, sagt Baggenstoss: «Ich beschäftige einen Hirten und habe mehrere Herdenschutzhunde».
Doch er kennt das Gefühl, wenn der Wolf ein Schaf erwischt: «Ich hatte auch schon hier unten Risse, nicht nur auf der Alp. Mittlerweile gibt es wohl keine Ecke mehr in der Schweiz, in der man als Nutztierhalter nicht damit rechnen muss.» Jedes tote Schaf bedeute für ihn einen emotionalen und finanziellen Verlust.
Das Nutztier als Beilage
Rund 300 Wölfe sind derzeit in der Schweiz unterwegs. Genau beziffern lässt es sich nicht, denn viele sind Grenzgänger. Ihre Ernährung besteht überwiegend aus Wildtieren, das zeigen Untersuchungen von Wolfskot. Das Nutztier ist quasi Beilage und macht rund 17 Prozent auf der wölfischen Speisekarte aus. Der grösste Teil davon: Schafe.
2024 und 2023 haben Wölfe rund 1'000 Schafe gerissen. Ein Bruchteil des Schweizer Schafbestands: Ende Juli 2025 sind gemäss der Datenbank «Identitas» 438’055 Schafe registriert.
Jedes Jahr verenden mehrere 10'000 Tiere, laut dem Bundesamt für Landwirtschaft hauptsächlich aufgrund von Krankheiten, Parasiten, Seuchen oder schlechter Witterung.
Trotzdem: Ein totes Tier ist für betroffene Landwirtinnen und Landwirte oft eine schmerzvolle Erfahrung. Hinzu kommt, dass es manchmal nicht nur bei einem gerissenen Schaf bleibt, wenn Wölfe in eine Herde eindringen. «Schafe sind keine Fluchttiere. Beim Wolf kann dann eine Art Reflex einsetzen», erläutert Zoologe Heinrich Haller, der bis 2019 Direktor des Schweizerischen Nationalparks war und sich mit dem Jagdverhalten von Wölfen auskennt.
«Surplus Killing»
Der Wolf gerate zwar nicht in einen Blutrausch, wie ihm nachgesagt werde. Dass er gleich mehrere Schafe reisse, wenn sich Gelegenheit dazu bietet, sei normales Raubtierverhalten: Fachleute sprechen dabei von «Surplus Killing». «Wölfe sind in der Lage, innert kurzer Zeit sehr viel Nahrung aufzunehmen», so Haller. Mit einem soliden Herdenschutz könne man aber viel ausrichten.
Dem stimmt Schäfer Baggenstoss zu: «Herdenschutz bedeutet aber auch Aufwand, Investitionen, Infrastruktur.» Das Budget des Bundesamts für Landwirtschaft für entsprechende Finanzhilfen beträgt jährlich rund 3 bis 3.5 Millionen Franken. Ausreichend scheint das nicht, denn der Bund schiesst jährlich zwischen 4 und 7 Millionen Franken dazu. Seit 2024 gibt es Direktzahlungen für Hirtinnen und Hirten. Obendrauf kommen Gelder aus kantonalen Förderprogrammen.
Ab diesem Jahr kommt der Bund aus Spargründen nur noch für die Hälfte der Kosten auf, wogegen das Parlament sich wehrt.
Die nackten Zahlen sind für Berufsschäfer Michael Baggenstoss nicht mehr als das: nackte Zahlen. Geht es um das Zusammenleben mit dem Wolf, brauche es Verständnis und Zugeständnisse von allen Seiten. «Der Wolf ist nicht ein Problem der Schafhalter. Er gehört allen. Wir alle müssen die Konsequenzen tragen, die er mit sich bringt.» Sei es ein gesperrter Wanderweg – oder dass man beim Biken von einem Herdenschutzhund angekläfft werde.