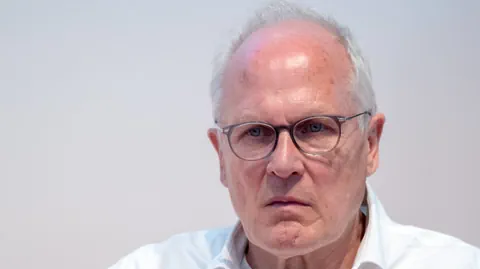Die «Paradise Papers» zeigen auch: In Afrikas rohstoffreichen Ländern wird sehr viel Geld gemacht. Das sieht man am Beispiel von Kongo, wo der Schweizer Rohstoffriese Glencore Kupfer- und Kobaltminen betreibt. Die Lizenzen zum Abbau der Bodenschätze kaufte Glencore für verhältnismässig wenig Geld. Geld, das aber die Mächtigen des Landes reich machte. Die Bevölkerung aber bleibt arm.
SRF News: Ist das Beispiel des Kongo typisch für die Art und Weise, wie in Afrika geschäftet wird?
Robert Kappel: Es ist in der Tat ein sehr typisches Geschäft. Wir kennen solche Arten von Geschäften schon seit vielen Jahren. Es handelt sich um kommerzielle Transaktionen, die leicht ins Unerlaubte gehen; in Verbindung mit Korruption geht es um ein System, mit dem die Ressourcen des Landes ausgebeutet werden, verbunden mit kriminellen Aktivitäten.
Es gibt den vielzitierten «Fluch der Ressourcen»: Sehr ressourcenreiche Staaten, in denen die Bevölkerung trotzdem arm ist und nur die Elite profitiert. Kann man heute in Afrika überhaupt Geschäfte machen?
Das geht auf jeden Fall. Auch wenn es negative Beispiele gibt, gerade im Rohstoffsektor, wo Korruption grassiert. Aber es gibt positive Beispiele von Unternehmen, die sehr klare Vorstellungen davon haben, wo sie investieren wollen. Sie kooperieren vernünftig mit dem betreffenden Staat und bezahlen ihre Steuern. Es gibt viele Beispiele dafür von Südafrika bis Senegal. Etliche Firmen wollen langfristig investieren und auch Arbeitsplätze schaffen, nicht nur im Rohstoffbereich, sondern auch im Industriebereich.
Gibt es Musterbeispiele unter den ressourcenreichen Ländern Afrikas?
Ein herausragendes Beispiel ist Botswana, das sehr reich an Rohstoffen ist, etwa an Diamanten. Das Land ist sehr gross, aber hat nur eine kleine Bevölkerung. Schon in den 1970er-Jahren haben die staatlichen Eliten begonnen, die Gelder aus dem Export von Diamanten in einen Staatsfonds zu legen. Sie legten diesen Fonds so an, dass nicht sofort auf ihn zugegriffen werden konnte, um irgendwelche staatlichen Investitionen zu finanzieren.
In Angola und im Kongo sind die Ressourcen besonders gross und die Bestechlichkeit sehr ausgeprägt.
Die Strategie war langfristig angelegt. Es ging darum, Botswana unabhängiger von Rohstoffen zu machen und Wert auf die Diversifikation der Industrie, des Tourismus, des Dienstleistungssektors zu legen. Der Weg, den Botswana eingeschlagen hat, findet auch international grosse Anerkennung.
Einen solchen Staatsfonds hat auch Angola, wie man in den «Paradise Papers» lesen konnte. Dort hat es aber nicht wirklich funktioniert. Kommt es trotz aller Vorsätze auf die Integrität der Institutionen an, wenn so etwas funktionieren soll?
Das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung. Der Staatsfonds von Angola unterscheidet sich vollkommen von demjenigen in Botswana. In Angola greifen Eliten auf die Gelder zu, es gibt illegale Geldflüsse: Das Land hat in den letzten Jahren im Durchschnitt acht Milliarden Euro jährlich an Kapitaltransfers verloren. Teilweise wurden diese auch über die Staatsfonds gemanagt. Angola ist also ein sehr schlechtes Beispiel.
Dieser Tango wird immer zu zweit getanzt.
Es kommt tatsächlich auf die Institutionen und auf die Bereitschaft der Eliten an, Gesetze gegen Korruption und für mehr Transparenz zu schaffen. Damit klar ist, wohin die Gelder fliessen und wer daran beteiligt ist. Auch beim Aufbau von Steuerbehörden kann viel getan werden. Allerdings sind diese in den afrikanischen Ländern oft sehr schwach, genauso wie die Anti-Korruptionsbehörden, die zudem oftmals politisch beeinflusst sind.
Also greift das Narrativ zu kurz: Böser reicher Norden, armer Süden?
Zu diesem System gehören immer zwei: Einerseits die ausländischen Unternehmen aus Europa, den USA und der ganzen Welt. Und eben auch die afrikanischen Staaten, die da mitspielen. Dieser Tango wird immer zu zweit getanzt. Es gibt Beispiele an Ländern, in denen versucht wird, die Institutionen zu verbessern, Transparenz herzustellen und dafür zu sorgen, dass ehrliche Investoren gefördert werden. Man sollte auf diese reformfähigen Länder setzen und nicht auf Negativbeispiele wie Angola und Kongo. In diesen beiden Ländern sind die Ressourcen aber auch besonders gross und die Bestechlichkeit sehr ausgeprägt.
Was könnte die Schweiz beitragen, um die Situation zu verbessern?
Sie könnte sehr viel machen. Die Schweiz ist ein Zentrum für Transaktionen von Kapitalflüssen, etwa auch aus Angola. Die Schweiz könnte auch durch Herstellung von Transparenz, den Beitritt zu «Global Financial Integrity», etwas tun. Diese Institutionen haben globale Normen und Standards dafür geschaffen, dass Gelder aus illegalen Transfers nicht in die Schweiz kommen, sondern dass die Dinge verfolgt werden können. Hier könnte sehr viel getan werden.
Das Gespräch führte Nicoletta Cimmino.