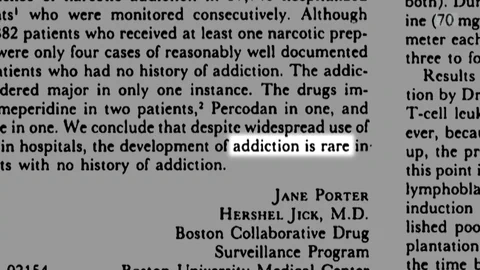Wer abhängig ist von Opiaten, kommt von den morphinhaltigen Medikamenten nur schwer wieder weg.
Neuste Zahlen legen die Vermutung nahe, dass sie zu häufig verschrieben werden. Von Verhältnissen wie in den USA mit Beschaffungskriminalität und Tausenden von Toten sind wir zwar weit entfernt. Abhängigkeit und Sucht sind aber auch in der Schweiz traurige Realität.
Zum Beispiel für Stefanie und Monika.
Stefanie konnte kürzlich einen besonderen Tag feiern: Ein Jahr ohne Sucht.
Vor dem erfolgreichen Entzug war sie fünf Jahre lang abhängig vom Medikament Oxynorm. Körperlich und psychisch. Eine schlimme Zeit im Zeichen von Schmerzen, Leid und Unfreiheit. «Die ganze Zeit haben meine Gedanken nur um das Medikament gekreist. Wie ich es wieder bekommen und besorgen kann – und gleichzeitig das Wissen, dass man das eigentlich nicht sollte.»
Monika – sie zieht es vor, anonym zu bleiben – steckt noch mitten in der Abhängigkeit. Opioide nimmt sie seit zehn Jahren. Jeden Tag. Alle acht Stunden.
Rückenschmerzen ohne korrekte Diagnose und zahlreiche Operationen waren ihr Weg in die Abhängigkeit. «Bei der ersten Operation dachte ich, ‹jetzt kommt alles gut›.» Dann dasselbe bei der zweiten Operation – und so weiter.» Zwei, drei, vier Jahre später hatte sich die Lage nicht verbessert, und immer noch war keine Besserung in Sicht. «Ich hätte nie gedacht, dass sich das zu einer ‹never ending Story› auswächst. Nie!»
Monika hat ihre Opioide immer in der Handtasche dabei. Ein stetig begleitender Fluch, mit dem sich damals auch Stefanie unerwartet konfrontiert sah: «Die Ärzte haben mir zwar gesagt, dass das süchtig machen könne – dass man das aber schon wieder weg bringe. Das hatte ich immer im Hinterkopf: ‹Es ist ja nur für eine gewisse Zeit.›»
Opioide gelten als die effektivsten Schmerzmittel, die der Medizin zur Verfügung stehen. Das sieht auch Pharmakologe Stephan Krähenbühl so. Abhängigkeit und Sucht als Nebenwirkung sind allerdings nie ganz verschwunden.
«Wenn man ein Opioid ununterbrochen zu sich nimmt, dauert es etwa eine Woche, bis man eine körperliche Abhängigkeit entwickelt.» Würde man die Einnahme stoppen, kommen die Schmerzen wieder zurück und man hat den Drang, das Medikament wieder zu nehmen.
«Personen mit gewissen Risikofaktoren können eine körperliche und psychische Abhängigkeit entwickeln, also eine Sucht. Davon ist man sehr schwer wieder wegzubringen.»
Stefanie war auch psychisch abhängig vom Opioid. «Bei mir ging es anfangs auch um das Wohlbefinden am Abend. Damals habe ich noch viel gearbeitet, einfach durchgemacht, um mir danach das Medikament geben zu können», erinnert sich Stefanie. «Das war Teil der Entspannung. Mit der Zeit habe ich es dann immer früher genommen.»
Bei Monika führen die Opiate auch zu einer gewissen Euphorie. «Man fühlt sich besser, es geht einem auch besser. Aber wenn man da alleine gelassen wird und sich der Arzt nicht kümmert, dann kann das auch böse enden.»
Wohin die massive Verschreibung von Opioiden führen kann, zeigt die Opioid-Krise in den USA, die bis heute noch nicht ganz ausgestanden ist. In geringerem Mass wirkte sich die der Krise zugrunde liegende WHO-Initiative zur besseren Schmerzbehandlung damals auch auf die Schweiz aus. Finanzielle Anreize zur Verschreibung waren hierzulande aber nie ein Thema.
Mittlerweile haben beide Länder eine Entwicklung durchgemacht: Laut Schätzungen des Internationalen Suchtstoffkontrollrats belegt derzeit die Slowakei den Spitzenrang bei der Opioid-Nutzung, gefolgt von Ungarn, Frankreich und Norwegen. Die Schweiz belegt Platz 5 – drei Plätze vor den USA, die nun auf Platz 8 liegen.
Zuverlässige Zahlen liefern Schweizer Studien: Zwischen 2006 und 13 gab es doppelt so viele Verschreibungen in Spitälern. Eine ganz aktuelle Studie belegt bis zum Jahr 2018 nochmals eine Steigerung um 40 Prozent – bei schweren Opioiden.
Was das bedeutet, weiss Joram Ronel, Leiter Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Spezialklink Barmelweid aus seiner täglichen Praxis. «Bei den Schmerzpatienten, die zu uns kommen, haben zwei Drittel eine lange Liste von Opiaten, die sie einnehmen.» Und anders als in den USA gehören die meisten nicht zu Bevölkerungsgruppen in schwierigen Umständen.
Wie auch Stefanie und Monika nicht.
Die beiden Frauen haben jahrelange Rückengeschichten hinter sich. Beide erlebten, dass ihre Schmerzen lange nicht genau lokalisiert werden konnten. Die Folge: Um den Schmerz in Schach zu halten, nahmen beide Opioide. Monika noch heute: «Weil die Ursache nie weg war, konnte ich die Medikamente nie absetzen.»
Auch bei Stefanie verlief die Ursachensuche lange erfolglos. Sie wurde von Spezialist zu Spezialist gereicht und bekam immer wieder zu hören, dass jetzt eigentlich alles gut sein müsste. «Da hat man halt irgendwann genug und nimmt eben die Opiate, damit es einem einigermassen gut geht.»
Schmerzspezialist Konrad Maurer beobachtet den Umgang mit Opioiden seit Jahren mit Argwohn. «Bei gewissen Schmerzmechanismen und -ursachen ist ihr Einsatz gut und wichtig. Bei anderen, wo es unklar ist, haben sie absolut nichts verloren», hält er klar fest.
Gerade bei Rückenschmerzen ist das Finden der Ursache(n) jedoch alles andere als einfach. Der Rücken ist eine komplexe Konstruktion aus Knochen, Wirbelkörpern, Bandscheiben, Kapseln, Bindegewebe und mehr. «Da sind ganz viele Strukturen, die weh tun können.»
«Puls»-Chats zum Thema
Der Rückenreport 2020 der Rheumaliga zeigt: Bei über 90 Prozent der Rückenschmerzen findet man keine spezifische Ursache. Die Annahme liegt nahe, dass bei einem Teil dieser Patientinnen und Patienten Opioide eingestzt werden.
Opioide geben statt Schmerzursache beseitigen: Das darf nicht sein, meint Maria Wertli vom Inselspital Bern, die seit Jahren den Umgang mit Opioiden in der Schweiz erforscht. Spätestens nach sechs bis acht Wochen Arbeitsunfähigkeit müsse das Problem radikal anders angegangen werden.
«Man arbeitet zum Beispiel mit Physiotherapie, schaut am Arbeitsplatz wo es Probleme gibt. Setzt auf Massnahmen statt Medikamente.» Dieses Denken, so der Eindruck der Ärztin, hat sich noch nicht überall durchgesetzt.
Umdenken müssen aus ihrer Sicht auch die Hausärztinnen und Hausärzte: «Bis sie die Leute zum Rheumatologen oder Orthopäden oder Wirbelsäulenchirurgen schicken, ist häufig schon viel Zeit vergangen. Drei Monate, sechs Monate. Da ist der chronische Schmerz eigentlich schon da.»
Die Hausärzte stehen also in Verdacht, zu lange mit der Überweisung zu warten und stattdessen Medikamente zu verschreiben, die gar nicht indiziert sind. Denn: Rückenschmerzen ohne klare Diagnose dürften laut Smarter Medicine und der Rheumatologischen Fachgesellschaft gar nicht mit Opioiden behandelt werden.
Studien zeigen nämlich, dass sie gar nicht viel helfen. «Sie haben kurzfristig eine bescheidenen Effekt», weiss Rheumatologe Diego Kyburz, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie. «Dem steht ein beträchtliches Ausmass an Nebenwirkungen gegenüber, die den kleinen Gewinn an Lebensqualität deutlich übersteigen können.»
Dass in der Schweiz so viele Opioide im Umlauf sind, liegt aber nicht nur an verschreibungsfreudigen Ärztinnen und Ärzten.
Zwei Problemfelder begünstigen die grosse Verbreitung:
1. Problemfeld: Opioid-Abgabe nach Spitalbesuch
Patienten, die im Spital eine Operation hatten und nach Hause entlassen werden, bekommen Opioide mit nach Hause. «Der Chirurg hat mir das einfach als Reserve mitgegeben, falls ich Schmerzen habe. Da wurde gar nicht darauf hingewiesen, dass man aufpassen müsse», erinnert sich Stefanie. «Und nach diesem einen Fläschchen, da ist man halt schon fast drin.»
Pharmakologe Stephan Krähenbühl pflichtet bei: «Es ist wahrscheinlich schon so, dass die meisten Opioideinnahmen primär im Spital angefangen und dann weiter gezogen werden.» Daten aus den USA zeigen, dass nach einer Knie- oder Hüftprothesen-Operation 90 Prozent der Patienten mit einem Opiat aus dem Spital gehen. «Wenn man das dann nicht abstellt, hat man viele Leute, die das weiter einnehmen, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre.»
Auch die leitende Ärztin Maria Wertli kennt das Problem beim Spitalaustritt: «Wenn man jemanden mit Schmerzen nach Hause lässt, gibt man zur Überbrückung der nächsten Tage eine Schachtel Opioide mit. Das ist in der Regel eine Packung für einen Monat.» Da sei die Schnittstelle zwischen Spital und ambulanter Betreuung definitiv eine Herausforderung: «Der Hausarzt muss es nachher stoppen. Patienten sollten die Opioide abgeben und dann nicht einfach beim nächsten Kopfschmerz einsetzen.»
Sorge bereitet dem Schmerzspezialisten Konrad Maurer, dass immer mehr Operationen in Zukunft ambulant durchgeführt werden und Patienten nach einer Operation gleich nach Hause gehen: «Man will ja, dass es ihnen gut geht und sie keine Schmerzen haben. Das ist natürlich ein Risikofaktor, dass noch mehr Opioide verschrieben werden.»
2. Problemfeld: Unkontrollierter Bezug
Zwar wird jede Verschreibung eines Opiats genau registriert. Aber es wird nicht kontrolliert, wie viele Opioide ein Patient von wem verschrieben bekommt.
Stefanie hatte bei fünf Ärzten gleichzeitig Opioide bezogen und rechnete eigentlich mit einer Reaktion seitens der Krankenkasse. Aber: «Die hat einfach bezahlt. Und ich war dankbar, dass das einfach übernommen wurde. Ich glaube, da findet viel zu wenig Kontrolle statt.»
Eine ähnliche Erfahrung machte Monika mit ihren Ärzten: «Einer von den Ärzten, ein Schmerzspezialist, hatte keine Ahnung, wann ich meine Packungen eigentlich fertig haben musste. Da konnte ich irgendein Datum angeben.»
Stephan Krähenbühl sieht im Moment vor allem eine Ärztegruppe in der Pflicht, Opiat-Verschreibungen unter Kontrolle zu haben «Die Hausärzte müssen informiert werden, dass ein Patient kommt mit einem Opioid. Nachher sind sie in der Pflicht, den Patienten zu begleiten und zu schauen, dass das korrekt abläuft.»
Schwieriger Ausstieg
Wer einmal von Opioiden abhängig ist, hat für den Ausstieg einen schweren, langen Weg vor sich. Dieser sollte von einem Arzt begleitet werden.
Stefanie hat den Ausstieg geschafft – nach einem sechswöchigen Entzug mit Schüttelfrost, Bauchkrämpfen und Fieber bis zur Erschöpfung. «Es war unbeschreiblich, was man da durchmacht. Man kann sich das im vornherein gar nicht vorstellen.» Das Leiden hat sich in unerwarteter Weise ausgezahlt: «Die unspezifischen Schmerzen sind wie von alleine verschwunden! Die waren ganz klar auf das Opiat zurückzuführen.»
Monika ist nicht süchtig, aber körperlich abhängig. Das hat sie gemerkt, als sie die Tablette einmal vergessen hat. «Ich hatte Hühnerhaut, Schüttelfrost, heiss, kalt, extreme Unruhe. Es ist so unangenehm, dass man es mit allen Mitteln vermeiden will.» Sie weiss, dass ihr Entzug Monate dauern wird und wartet auf den richtigen Moment.