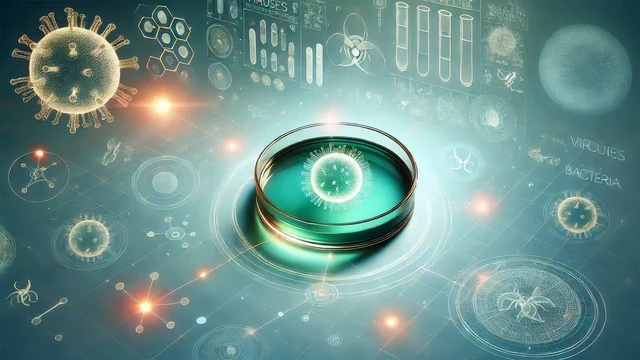James Collins, Professor für Bioengineering am Massachusetts Institute of Technology MIT, ist in Fachkreisen weltbekannt für seine Forschung. Schon in der Vergangenheit hat seine Gruppe für Schlagzeilen gesorgt mit neuen Substanzen, die mithilfe von KI entdeckt worden waren. Die neue Studie gehe viel weiter, sagt Collins: «Die KI bewegt sich darin weg vom reinen Entdeckungswerkzeug hin zum Designtool.»
Entstanden sind so zwei neue Antibiotika: das eine gegen resistente Gonorrhö (auch als die Geschlechtskrankheit «Tripper» bekannt), das andere gegen resistente MRSA.
Gefürchtet ist dieser multiresistente Keim vor allem in Spitälern und Pflegeheimen, wo er oft Ursache gefährlicher Infektionen ist.
Vom Screening zum Design
In früheren Studien nutzte James Collins Künstliche Intelligenz für «virtuelles Screening». Dabei durchforstet eine entsprechend trainierte KI riesige Bibliotheken bekannter Moleküle nach antibiotischen Eigenschaften, die ein bestimmtes Bakterium bekämpfen sollen.
In seiner neuen Studie haben Collins und sein Team nun einen fortgeschrittenen Ansatz gewählt: Sie benutzen die KI nicht mehr nur zum Screenen, sondern lassen ihr sozusagen «freie Hand», um Moleküle von Grund auf neu zu bauen.
Das KI-Modell kreierte so fast 30 Millionen chemische Verbindungen – eine ungeheure Zahl! 24 davon wählten die Wissenschaftler in mühsamer Kleinarbeit aus, um sie künstlich im Labor herzustellen und im Reagenzglas zu testen. Gerade sieben Moleküle blieben schliesslich übrig, die im Labor und im Tierversuch eine antibiotische Wirkung zeigten – wie gewünscht gegen Gonorrhö-Bakterien und gegen MRSA.
KI erschafft sehr viele Dinge, die eigentlich gar nichts taugen – obwohl sie dafür trainiert wurde. Umgekehrt wissen wir auch nicht, wie viele vielleicht wirksame Substanzen die KI verpasst hat.
Adrian Egli ist Professor für medizinische Mikrobiologie an der Universität Zürich und forscht ebenfalls mit KI. Er findet den Ansatz der Studie grundsätzlich sehr gut, ebenso wie die beiden Bakterien, die die US-Forscher im Fokus haben.
Dass aus fast 30 Millionen «möglichen» Antibiotika-Treffern am Ende nur eine Handvoll übrigbleiben, zeige aber auch, «dass die KI sehr viele Dinge erschafft, die eigentlich gar nichts taugen – obwohl sie dafür trainiert wurde», sagt Egli. Und: «Umgekehrt wissen wir auch nicht, wie viele vielleicht wirksame Substanzen die KI verpasst hat.»
Noch lange nicht praxisreif
Eine weitere Unbekannte ist, ob und wann diese Moleküle dereinst beim Menschen eingesetzt werden können. Dafür brauche es viele weitere Schritte und vor allem klinische Studien, sagt Marc Gitzinger, CEO des Schweizer Biotech-Unternehmens Bioversys mit Sitz in Basel: «Während die Moleküle hier eine erste Wirkung zeigen gegen interessante bakterielle Stämme, sind sie noch weit davon entfernt, ein aktives Medikament zu sein, das auch wirklich an den Ort des Geschehens kommt im Menschen.»
MIT-Forscher James Collins bestätigt diese Sicht. Seine Gruppe arbeite nun daran, die sieben durch KI identifizierten Moleküle fit zu machen für klinische Tests am Menschen. Ab da übernehmen andere Forscher.
Generell gehe es bei KI darum, diese möglichst intelligent einzusetzen, sagt James Collins. Konkret: «Diejenigen Forschungsgruppen, denen es gelingt, menschliche Intelligenz und Maschinen-Intelligenz möglichst effektiv zu verknüpfen, werden in der Antibiotikaentwicklung erfolgreich sein.»