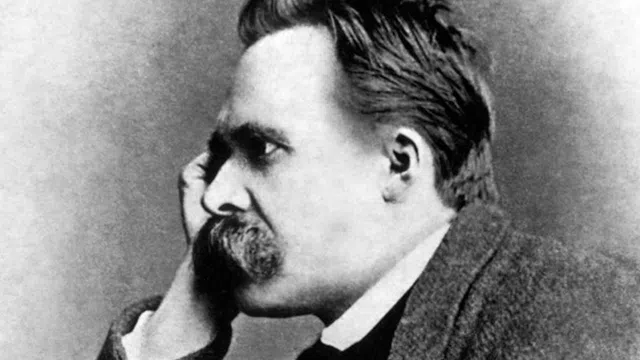Am 25. August 1900 starb der Ausnahmedenker Friedrich Nietzsche im deutschen Weimar: «umnachtet», wie es damals hiess. In der Schweiz produzierte Nietzsche die meisten seiner Schriften – und prägte Worte, die bis heute in vieler Munde sind, etwa «Freigeist» oder «jenseits von Gut und Böse». Auch Sätze wie: «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.» Und natürlich sein Verdikt: «Gott ist tot.»
«Düppig», schwül und drückend – so war das sommerliche Basel schon im 19. Jahrhundert. Nichts wie weg, dachte sich der Migräniker Friedrich Nietzsche. Und flüchtete in südlichere Gefilde. Und das, obwohl Basel es doch so gut mit ihm meinte.
Die Universität Basel berief Friedrich Nietzsche mit nur 24 Jahren zum ausserordentlichen Professor für Altphilologie. Da hatte er noch nicht einmal einen Doktortitel in der Tasche. Der jugendliche Professor aus Deutschland galt als wissenschaftliches Talent. So fand Nietzsche rasch interessierte Aufnahme in Basel: an der Universität ebenso wie in der Basler Oberschicht.
Besonders gern tauschte er sich mit dem Kulturhistoriker Jacob Christoph Burckhardt aus. Freundschaft schloss Nietzsche mit dem Theologen und Kirchenhistoriker Franz Overbeck. Mit Overbeck lebte er sogar im selben Haus, in einer Art Gelehrten-WG.
Frühpensioniert mit 34
Doch diesen privilegierten Job in Basel konnte Nietzsche nur rund zehn Jahre lang ausüben. Die gesellschaftlichen und pädagogischen Pflichten, welche mit der Professur einhergingen, wurden für den lärmempfindlichen Nietzsche immer mühsamer. Schliesslich wurde er mit 34 Jahren frühpensioniert. Basel zeigte sich nobel und zahlte Nietzsche das volle Ruhegehalt.
Von Migräneattacken geplagt flüchtete Nietzsche nach Italien, Südfrankreich und schliesslich ins Oberengadin, immer auf der Suche nach einem ihm bekömmlichen Klima.
Nun habe ich wieder mein geliebtes Sils Maria im Engadin, den Ort, an dem ich einmal sterben will.
Doch damals, Ende des 19. Jahrhunderts, war Nietzsches Schmerzleiden kaum zu lindern. Lediglich in Sils Maria konnte der von extremen Kopfschmerzen geplagte Herr Professor etwas durchatmen. Er fand hier liebenswürdige Wirtsleute, die sein kleines Kämmerlein sogar eigens für ihn dunkelgrün tapezierten, weil Nietzsche das als angenehm empfand.
So konnte er kreativ werden. Die über 100 Kilogramm Bücher aus Basel kamen mit der Postkutsche nach. «Nun habe ich wieder mein geliebtes Sils Maria im Engadin, den Ort, an dem ich einmal sterben will», notierte Nietzsche.
Nietzsche liebte die Stille in Sils. Er wollte auch keinen Besuch. Seine Mutter sollte ihm ein «Milchschinkli» ins Engadin schicken, aber bitte ein nicht zu salziges, und sie solle auch keinem sagen, wo er sei.
Der Philosoph suchte die Einsamkeit. Diese nannte er schliesslich sogar die für ihn erstrebenswerte Lebensform. Doch starb Friedrich Nietzsche weder einsam noch glücklich – noch in Sils Maria. Am 25. August 1900 schied er «umnachtet» in Weimar von dieser Erde.
-
Bild 1 von 2. Im heutigen Museum Nietzsche-Haus in Sils Maria im Engadin wohnte Friedrich Nietzsche regelmässig in den Sommermonaten der 1880er-Jahre, bis kurz vor seinem geistigen Zusammenbruch 1889. Das Gebäude ist seit 1960 als Museum eingerichtet. Bildquelle: Keystone/Str.
-
Bild 2 von 2. Auf der Halbinsel Chastè am Silsersee, unweit von Sils Maria, befindet sich der Nietzsche-Gedenkstein, der im Todesjahr des Philosophen zu seinem Andenken errichtet wurde. Bildquelle: Paebi/Wikimedia Commons.
Die heutige Medizin vermutet bei Nietzsche eine genetisch bedingte Nervenkrankheit namens CADASIL. Diese äussert sich in starken Kopfschmerzen, Migräneattacken bis zu Erbrechen und Ohnmacht, später folgen kleine Hirnschläge und schliesslich Demenz. Genauso grauenvoll war der Verlauf bei Nietzsche.
Die letzten zehn Lebensjahre war er zu nichts mehr in der Lage. Er musste von seiner Mutter gepflegt werden, und als diese starb von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche. Das, obwohl Nietzsche «Mitleid» verabscheute.
Die Jahre in der Schweiz waren die produktivsten: In Basel schrieb er seine «Unzeitgemässen Betrachtungen» und anderes, was ihn als Philosophen bekannt machte. Im Oberengadin, respektive am Ufer des Silvaplaner Sees, «begegnete» ihm schliesslich Zarathustra.
Die andere, wahre Begegnung, nämlich die mit Richard Wagner, führte bei Nietzsche zu einer Abkehr – von Wagner und dessen «Kunstreligion».
Die Wagner-Villa: Ein Offenbarungsort?
Mehrfach war der Philosoph für mehrere Tage auf Besuch in der schönen Villa im Luzernischen, wo Richard Wagner und dessen Frau Cosima im wahrsten Wortsinn «Hof hielten».
Anfangs war die Verzückung gegenseitig: Nietzsche bewunderte Wagner, und Wagner sah in Nietzsche einen intellektuellen Unterstützer seiner Kunst-Visionen.
Nietzsche komponierte in jungen Jahren selbst Musik. Ausserdem dichtete er. Vertonte seine Gedichte selbst. In der Kunst sah Nietzsche zeitweise zu Klang gewordene Philosophie.
Doch in der Begegnung mit Wagner realisierte Nietzsche schliesslich, dass dessen Tempel für die Kunst, wie Wagner ihn in Bayreuth errichtete, genauso trügerisch wäre wie Religion. In «Menschliches, Allzumenschliches» schreibt Nietzsche: «Man muss Religion und Kunst wie Mutter und Amme geliebt haben, sonst kann man nicht weise werden.»
Auch Wagners aufwendigen Lebensstil in Tribschen, dessen Arroganz und Selbstinszenierung stiessen Nietzsche ab. Ferner widersprach Nietzsche mehrfach und öffentlich dem schon manischen Antisemitismus Wagners.
Dem Thema Judenhass bei Wagner und wie sich Nietzsche dazu stellte, widmet sich das heutige Museum in der Wagner-Villa Tribschen ausführlich, auch mit Sonderveranstaltungen an Nietzsches Todestag.
Endgültig als «Verrat» seines eigenen Denkens, seines Atheismus und seines Verzichts auf jedes Jenseitige empfand der Philosoph Nietzsche Wagners Oper «Parzifal». Wagner war also nicht der seelenverwandte «Freigeist», wie ihn Nietzsche sich erhofft hatte. Wagners Musik bereite ihm nun nur noch Kopfschmerzen – im doppelten Sinne.
«Ja» zu Leben und Leid
Ganz anders als das Christentum und ganz anders als die Kunstreligion Wagners war das, was Nietzsche zwischen Migräneattacken auf stundenlangen Spaziergängen im schönen Oberengadin ersann.
Fünf bis sieben Stunden täglich soll er auf Philosophensohlen unterwegs gewesen sein im Engadin. Immer mit dabei: ein Notizbuch für die Ideen, die ihm beim Anblick von Silser See, Arvenhölzern und Bergpanorama kamen.
Dabei stand nur etwa seine Idee vom Übermenschen im Widerspruch zu seinem eigenen Siechtum. Doch Nietzsche wollte «Ja» zum Leben sagen, auch zum Leid – und zwar ohne einzuknicken vor einem Gott.