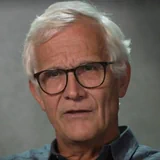Wie kann sich jemand dermassen am Leid anderer Menschen ergötzen? Wie funktioniert so eine Psyche? Diese Fragen stellen sich angesichts der Berichte über eine Art Scharfschützentourismus im Bosnienkrieg in den 1990er- Jahren. Über Jahre hinweg sollen Personen viel Geld bezahlt haben, um in Sarajevo auf Zivilistinnen und Zivilisten schiessen zu dürfen – offenbar zum Spass. Bei solchen Verbrechen gehe es den Tätern darum, die zerstörerischen Folgen des eigenen Handelns zu spüren. Das sagt Marc Graf, Professor für forensische Psychiatrie an der Universität Basel.
SRF News: Was haben Sie gedacht, als Sie von den Berichten über diese Sniper-Touristen gehört haben?
Marc Graf: Das ist natürlich eine traurige, erbärmliche Geschichte. Dabei geht es um Phänomene, die wir in allen kriegerischen Konflikten sehen.
Wie kann ein Mensch so etwas Böses tun?
Ich würde das eine Art destruktive Selbstwirksamkeit nennen. Die meisten Menschen möchten selbstwirksam sein. Das heisst: Wir haben einen starken inneren Antrieb, etwas zu bewirken und auch zu sehen, was das auslöst. Und meistens gelingt das auf eine konstruktive Art im ganz normalen Alltag – in Beruf, Beziehungen, Sport und so weiter.
Sie wollen Selbstwirksamkeit erleben, indem sie schädigen, zerstören.
Aber manchen Menschen reicht das nicht. Oder sie können es nicht, weil sie nicht die notwendigen Strategien dafür erlernt haben. Und die wollen dann Selbstwirksamkeit erleben, indem sie Dinge oder andere Personen schädigen, zerstören – in diesem Fall offenbar auf wehrlose Opfer schiessen.
Worum geht es den Tätern?
Es geht ganz stark darum, Macht zu fühlen. Die Gedanken könnten sein: Ich tue Dinge, von denen andere nicht einmal zu träumen wagen. Ich bin der gefährlichste aller Täter, der Super-Sniper. In der maximalen Steigerung geht es darum, Gott zu spielen. Gott entscheidet über Leben und Tod. Der Sniper, der da irgendwo in den Hügeln rund um Sarajevo liegt, sucht sich ein Opfer aus und sagt sich: ‹Für dich hat jetzt die letzte Stunde geschlagen!› Und dann drückt er ab.
Woher kommt diese Empathielosigkeit?
Das ist ein grosser Irrtum. Es ist eben das Gegenteil von empathielos. Erst dadurch, dass ein Täter die Perspektive des Opfers einnehmen kann, beispielsweise die Todesangst, entsteht das Gefühl von Macht und Grandiosität. Für diesen Perspektivenwechsel braucht es Empathie.
Bei manchen Menschen funktioniert diese Bremse nicht.
Das ist beim Sadismus auch so. Der Sadist quält, weil es ihm Lust bereitet und weil er eben in der Lage ist, sich in die Lage des Opfers hineinzuversetzen, die Tat aber aus der Perspektive des Aggressors erlebt.
Wie viele Menschen ticken so?
In dieser extremen Ausprägung zum Glück nur sehr wenige. In der forensischen Psychiatrie haben wir die Möglichkeit, solche Leute zu untersuchen. Dort stellt man eben genau das fest, dass dieses ultimative Machtgefühl für sie so berauschend ist, dass sie es immer wieder erleben wollen. Daraus kann sich ein Teufelskreis entwickeln, dass die Taten immer extremer werden.
Was ist denn bei diesen Menschen anders?
Eine mögliche Erklärung ist ein Areal im Vorderhirn, der ventromediale präfrontale Kortex. Es hilft dabei, die Gefühle anderer nachzuempfinden. Damit funktioniert es bei den meisten Menschen als eine Art Bremse, dass sie nicht solche schrecklichen Dinge tun. Und wir wissen aus der Forschung, dass es Menschen gibt, bei denen dieses Hirnareal, diese Bremse, weniger gut funktioniert.
Das Gespräch führte Raphaël Günther.