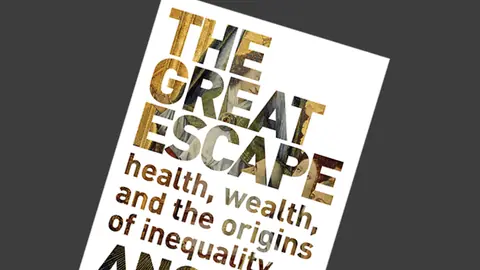135 Milliarden US-Dollar gibt die Weltgemeinschaft für staatliche Entwicklungshilfe aus. Mit Stolz klopfen sich die Vereinten Nationen auf die Schultern, was sie alles mit den Hilfsgeldern erreicht haben. Doch der Nutzen ist nicht leicht messbar. Wirtschaftsprofessor Angus Deaton verortet sogar grossen Schaden durch die Flut der Hilfsgelder. Die gute Absicht genüge nicht. Entwicklungshilfe erscheint als Kraft, die zwar das Gute will und doch das Böse schafft.
Wie aber kann es sein, dass Impfkampagnen, dass Unterricht in Rechnen, Schreiben und Lesen schlecht sein sollen? Deaton bestreitet den unmittelbaren Nutzen solcher Hilfe nicht, aber er geht einen Schritt weiter und schaut sich die Auswirkungen der Hilfe auf die Gesellschaft an. Da die Entwicklungshilfe von aussen kommt und nicht vom Staat selbst erbracht wird, hat sie seiner Ansicht nach fatale Folgen.
Die Zerstörung des Gesellschaftsvertrags
In Afrika gibt es einige Staaten, die zwanzig, vierzig oder achtzig Prozent des Haushalts von der Entwicklungshilfe finanziert bekommen. Gelder in solch hohem Ausmass beeinflussen das Verhältnis zwischen Regierung und Bevölkerung. Der Gesellschaftsvertrag werde gestört, wie Angus Deaton betont: «Ohne ein demokratisches oder wechselwirksames Zusammenspiel von Steuern und Ausgaben» könne der Staat nicht funktionieren.
In der Schweiz ebenso wie in den USA übernimmt der Staat wichtige Dienstleistungen, und wenn der Bürger mit der Leistung des Staats und seinen politischen Vertretern nicht zufrieden ist, kann er sie abwählen. Aber wenn die Dienstleistungen von aussen herangetragen würden, funktioniere dieser Mechanismus nicht mehr. Das Zusammenspiel von Verantwortungs-Übertragung und Rechenschafts-Pflicht, wie es in einer modernen Gesellschaft besteht, werde gestört. Entwicklungshilfe behindert laut Deaton deshalb die Entstehung eines funktionierenden Staates.
Hilfe für statt Hilfe in
Damit Entwicklungshilfe den Gesellschaftsvertrag nicht antastet, schlägt Angus Deaton vor, nicht länger Hilfe in einem Land zu leisten. Stattdessen müsse man Hilfe für ein Land leisten. Etwa im Bereich Tropenkrankheiten könnten die Industrienationen viel mehr tun. «Es wird kaum Geld für die Malariaforschung ausgegeben und fast nichts für Ebola», erklärt Deaton, «weil die Krankheiten amerikanische Bürger nicht betreffen. Würde sie die Amerikaner betreffen, würde die Regierung sehr viel Geld ausgeben. Wenn wir den Menschen also helfen wollen, können wir grosse Summen für die Erforschung solcher Krankheiten spenden.»
Auch im Bereich Wirtschaftsverträge sieht Ökonom Deaton Potenzial. Wenn heute ein Land wie Honduras ein Freihandelsabkommen mit den USA abschliessen wolle, werde die US-Industrie alles daran setzen, ihre Interessen mit einer Armee von Rechtsanwälten durchzusetzen. «Diese Jungs verdienen Millionen, um die Verträge auszuarbeiten. Und Honduras? Wen haben die schon? Welche Ressourcen haben solche Länder? Das ist nicht auf gleichem Niveau».
Theoretisch könne die Weltbank Hilfestellung leisten, meint Deaton, aber «das wird natürlich nicht passieren, da die USA es nicht zulassen.» Die in Washington ansässige Weltbank ist klar amerikanisch dominiert, was sich schon darin zeigt, dass die USA seit der Gründung sämtliche Präsidenten gestellt haben. Das hat die Kritik zahlreicher Schwellenländer ausgelöst. Inzwischen gründen allen voran die BRIC Staaten eigene Entwicklungsbanken. Deaton sieht in ihnen natürliche Partner der Entwicklungsländer. Sie könnte den Entwicklungsländern Experten zur Seite stellen, die sie beim Aushandeln bilateraler und multilateraler Handelsverträge beraten. Wer helfen will, sollte also die neuen Entwicklungsbanken stärken.
Der Zynismus der Helfer
Die UNO und mit ihr die Entwicklungshilfe-Industrie hielten aber an alten Rezepten fest und diskutierten lieber das Spendenaufkommen. So fordern die Vereinten Nationen 0,7 Prozent des BNP von den reichen Staaten, um Geld für neu formulierten Entwicklungsziele aufzutreiben. «Es geht viel zu sehr um uns und viel zu wenig um die Bedürfnisse der Menschen, die die Hilfe bekommen», kritisiert Deaton.
Wenn wir die Mechanismen begriffen haben, dürften wir an den überkommenen Rezepten nicht länger festhalten. «Es ist sehr zynisch und ausgesprochen bösartig etwas zu tun, das den Menschen schadet. Wenn wir helfen, nur um uns gut zu fühlen, wenn wir uns sagen, wir müssen etwas für die Menschen tun und deswegen spende ich 1000 Franken, dann ist das nicht gut, denn wir tun es für uns.»