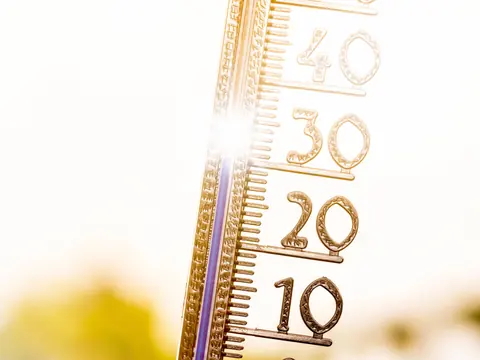Der Asphalt flimmert, im Schatten steht die Luft. Es ist Mitte August und in vielen Schweizer Städten zeigen die Thermometer über 36 Grad an. In den Krankenhäusern häufen sich Hitzefälle, in den Altersheimen werden Ventilatoren verteilt – und auf den Geburtsstationen kämpfen Schwangere mit Kreislaufproblemen.
Solche Szenarien sind keine Science-Fiction, sondern in heissen Sommern Realität.
Nicht jede Frau ist bei Hitze generell stärker gefährdet – bestimmte Gruppen von Frauen allerdings schon.
Allein im Hitzesommer 2022 sind in Europa laut einer Studie über 60'000 Menschen an den Folgen extremer Temperaturen gestorben. Auch in der Schweiz war die Übersterblichkeit markant – besonders betroffen: ältere Menschen. Und unter ihnen: mehr Frauen als Männer. Ein Zufall?
«Es ist nicht so, dass jede Frau bei Hitze generell stärker gefährdet ist – bestimmte Gruppen von Frauen allerdings schon. Ältere Frauen oder solche mit chronischen Erkrankungen zum Beispiel», sagt Ana Maria Vicedo Cabrera, Klimawissenschaftlerin und Professorin für Umwelt-Epidemiologie an der Universität Bern.
Unterschätzte Gesundheitsfrage
Besonders gut belegt sei die brenzlige Situation auch bei Schwangeren: «Bei ihnen sind Stoffwechsel und Körpertemperatur ohnehin schon erhöht, und die Fähigkeit zur Thermoregulation eingeschränkt. Das kann zu Komplikationen wie Frühgeburten führen.»
Schon ein einziger Tag mit extremer Hitze kann das Risiko für schwere Schwangerschaftskomplikationen erhöhen.
Tatsächlich zeigen mehrere Studien einen Zusammenhang zwischen Hitzetagen und frühzeitigen Geburten. «Schon ein einziger Tag mit extremer Hitze kann das Risiko für schwere Schwangerschaftskomplikationen erhöhen», lautet das Fazit des kürzlich publizierten Berichts der US-Klimaorganisation Climate Central. Auch in Europa, auch in der Schweiz.
Wahrnehmung und Risikoverhalten klaffen auseinander
Für andere Gruppen von Frauen – etwa Alleinstehende oder Frauen in pflegenden Berufen – fehlen diese präzisen Daten aber. Und genau das wirkt sich auf den Hitzeschutz aus. Denn was in der Forschung kaum untersucht wird, findet selten Eingang in konkrete Massnahmen.
Martina Ragettli, Epidemiologin beim Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut, bestätigt das: «Die Auswirkungen von Hitze auf Frauen sind bisher kaum systematisch in den Hitzeschutzstrategien der Kantone oder auf Bundesebene berücksichtigt worden. Schwangerschaft ist zwar teilweise als Risikofaktor aufgeführt, aber konkrete Massnahmen gibt es nicht.»
Umso entscheidender ist es, dass gefährdete Gruppen gut informiert sind und Schutzempfehlungen im Alltag beherzigen. Doch eine Hitzekompetenzbefragung des BAG vom Sommer 2023 macht deutlich: Allein mit Wissen ist es nicht getan.
Vielen Menschen ist zwar bewusst, dass Hitze schaden kann – doch sie handeln nicht entsprechend. Besonders bei vulnerablen Gruppen unterscheidet sich das, was sie wahrnehmen, oft deutlich von ihrem tatsächlichen Risiko, erklärt Martina Ragettli.
Vielleicht, weil wir – auch in der Forschung – gewohnt sind, den Körper als neutral zu betrachten. Als wäre die medizinische Reaktion auf Umweltbedingungen bei allen gleich. Ist sie aber nicht.
Hier setzt Ana Maria Vicedo Cabrera mit ihrer Forschung an: Was passiert im weiblichen Körper, wenn die Temperaturen steigen? Und wie unterscheidet sich das – etwa zu einem gleichaltrigen Mann? Bisher hat die Wissenschaft darauf (noch) erstaunlich wenige Antworten parat.
In der Schweiz fehlen oft Daten, die eine detaillierte Geschlechteranalyse erlauben. Vieles läuft über Alter oder Todesursache, nicht über Gender.
Doch es gibt sie, die Studien, die auf physiologische Unterschiede hinweisen: Frauen haben im Schnitt eine geringere Schweissproduktion, ihre Thermoregulation ist hormonell beeinflusst – etwa durch den Menstruationszyklus, die Wechseljahre oder hormonelle Veränderungen in der Menopause. Der Körperfettanteil ist meist höher, was die Wärmeabgabe über die Haut erschwert, während die im Schnitt kleinere Körperoberfläche weniger Möglichkeiten zur Abkühlung bietet.
«Trotzdem sind die Unterschiede noch nicht ausreichend erforscht», betont Vicedo Cabrera. Oft basierten diese Studien auf kleinen, nicht-repräsentativen Gruppen. Martina Ragettli ergänzt: «In der Schweiz fehlen oft Daten, die eine detaillierte Geschlechteranalyse erlauben. Vieles läuft über Alter oder Todesursache, nicht über Gender.»
Nicht nur eine Frage des Alters
Ein Beispiel: Übersterblichkeit bei Hitzewellen betrifft überproportional oft Frauen über 75. Doch ist das biologisch bedingt – oder ein Resultat sozialer Faktoren wie Alleinleben, Pflegeverantwortung oder geringeres Einkommen?
Dazu kommt, dass sich auch bei Männern geschlechterspezifische Muster zeigen: Studien weisen etwa auf ein erhöhtes Risiko für akute kardiovaskuläre Ereignisse an besonders heissen Tagen hin – insbesondere bei Männern mittleren Alters. Diese treten oft unmittelbar am Hitzetag auf, während bei Frauen tendenziell verzögerte gesundheitliche Folgen registriert werden. Der genaue Hintergrund dieser zeitlich unterschiedlichen Effekte ist noch unklar. Sie zeigen aber, dass geschlechtersensible Forschung in beide Richtungen notwendig ist.
Nicht nur der Körper macht den Unterschied. Auch die gesellschaftliche Rolle entscheidet mit darüber, wie gross das Risiko durch Hitze ist. Wer pflegt, wer organisiert den Haushalt, wer verzichtet auf eine Pause, weil noch jemand anderes versorgt werden muss? Die Antwort: oft Frauen. Und genau das macht die Diskussion um Geschlechtergerechtigkeit im Klimaschutz so komplex – und so dringend.
Denn Hitze wirkt nicht nur physiologisch. Sie wirkt auch sozial. Frauen, besonders ältere, leben öfter allein, sind häufiger pflegebedürftig oder pflegen selbst. Sie haben weniger Zugang zu Ressourcen wie kühlende Wohnräume oder flexible Arbeitsbedingungen. Das zeigt sich etwa in Studien aus Frankreich und Kanada, wo Hitzewellen in Altersheimen und im ambulanten Bereich besonders stark auf ältere Frauen wirkten.
Hitze-Apps und Trinkpausen helfen
«Solche Faktoren werden in der Schweiz noch zu wenig systematisch erfasst», sagt Ragettli. Dabei wäre gerade das wichtig, um gezielte Massnahmen zu entwickeln – so wie etwa beim Projekt der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Fachhochschule Südschweiz: Dieses Projekt untersucht unter anderem wie sich Hitze auf Stress, psychische und kognitive Gesundheit und die Schlafqualität von Spitex-Gesundheitsfachpersonen auswirkt.
Hitzewarnungen per App
Erste Ergebnisse deuteten darauf hin, so Ragettli, dass verhaltensbezogene und organisatorische Massnahmen, etwa gezielte Trinkpausen oder App-basierte Hitzeschutz-Hinweise, wirksam sein könnten.
Internationale Perspektive: Frankreich als Vorreiter?
Auch international gibt es erste Anläufe, geschlechterspezifische Risiken systematisch zu berücksichtigen: In Frankreich etwa wurden nach dem verheerenden Hitzesommer 2003 nicht nur nationale Hitzewarnsysteme aufgebaut, sondern auch gezielt vulnerable Gruppen in den Fokus genommen. Pflegebedürftige – oft allein lebende ältere Frauen – können so frühzeitig kontaktiert und versorgt werden. «Solche Ansätze zeigen, wie wichtig es ist, soziale Faktoren wie Alter, Geschlecht und Lebensumstände in die Hitzeschutzplanung einzubeziehen», so Ana Maria Vicedo Cabrera.
Auch Kanada untersuchte nach mehreren extremen Hitzewellen gezielt, wie sich Pflegearbeit – die überwiegend von Frauen geleistet wird – auf die gesundheitliche Belastung auswirkt. Die Forschung dazu steht noch am Anfang, aber sie rückt die Verbindung zwischen sozialer Rolle und körperlichem Risiko stärker ins Zentrum.
Erste Massnahmen – und noch viele Lücken
Immerhin: Es tut sich etwas. Mehrere Schweizer Kantone haben in den letzten Jahren Hitzeschutzpläne eingeführt. In Basel-Stadt gibt es eine Hitze-Hotline für Seniorinnen und Senioren, in Genf kühle Inseln und klimatisierte Aufenthaltsräume. Der Bund hat eine Toolbox mit Empfehlungen herausgegeben.
Gefragt nach konkreten Lücken benennt Ragettli Unterschiede zwischen den Regionen: «In der Westschweiz wurden schon nach dem Hitzesommer 2003 Aktionspläne erarbeitet, entsprechend hat man dort mehr Erfahrung in der Umsetzung.» In der Deutschschweiz sei das Engagement geringer, doch es nehme stetig zu. «Ich würde mir aber mehr Zusammenarbeit zwischen Sektoren wie Gesundheitsamt und Raumplanung wünschen», so die Epidemiologin.
Individuelle Informationskampagnen
Auch die gendersensible Kommunikation ist ausbaufähig: «In Deutschland gab es ein Pilotprojekt mit WhatsApp-Nachrichten für Schwangere. Solche zielgruppengerechten Ansätze könnten auch bei uns helfen.»
Das bestätigt auch die Praxis: Die beiden Hebammen Violeta Saez und Ines Amaro berichten, dass viele Schwangere gar nicht wissen, wie stark sie durch Hitze gefährdet sind. «Der Bauch ist als Körperfläche besonders empfindlich, das ist vielen Frauen gar nicht so klar.»
Informationskampagnen wie jene, die Ana Maria Vicedo Cabrera vorschlägt, wären aus ihrer Sicht dringend nötig – gerade weil die Risiken kaum thematisiert werden.
Zwischen Hitzestatistiken, Sterblichkeitsraten und Massnahmenkatalogen stellt sich eine grundlegende Frage: Wie wäre die Lage heute, wenn das Geschlecht in der Klimagesundheitsforschung von Beginn an systematisch mitgedacht worden wäre? Solche Überlegungen sind kein Gedankenspiel – sie zeigen auf, wo strukturelle Lücken bestehen.
Und sie helfen zu verstehen, warum bestimmte Gruppen bis heute weniger sichtbar sind, wenn es um gesundheitlichen Hitzeschutz geht.
Wie belastbar sind die Daten?
Die Forschung beginnt sich zwar zu bewegen: Immer mehr Studien liefern Hinweise auf geschlechtsspezifische Unterschiede – besonders in sensiblen Lebensphasen wie Schwangerschaft oder hohem Alter. Doch wie belastbar sind diese Daten eigentlich? Und wie lassen sich biologische von sozialen Ursachen unterscheiden? «In vielen Bereichen stehen wir noch am Anfang», sagt Vicedo Cabrera. «Gerade deshalb ist es wichtig, die vorhandenen Erkenntnisse differenziert zu kommunizieren – ohne vorschnelle Schlüsse.»
Kurzfristiger Schutz, gezielte Kommunikation und langfristige Anpassung – nur das Zusammenspiel wirkt nachhaltig.
Was es brauche, seien koordinierte, partizipative Massnahmen, wie sie in einigen Projekten mit Hausarztpraxen, Spitex und Gemeinden bereits erprobt werden. «Für mich ist zentral», sagt Ragettli, «dass wir auf allen Ebenen aktiv werden: Kurzfristiger Schutz, gezielte Kommunikation und langfristige Anpassung – nur das Zusammenspiel wirkt nachhaltig.»
Und die Politik? Sie ist gefordert, geschlechtersensiblen Hitzeschutz nicht länger als Nischenthema zu behandeln, sondern als festen Bestandteil einer gerechten Klimaanpassungspolitik zu begreifen. Denn wer gezielter schützt, schützt am Ende alle besser – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Lebenslage.