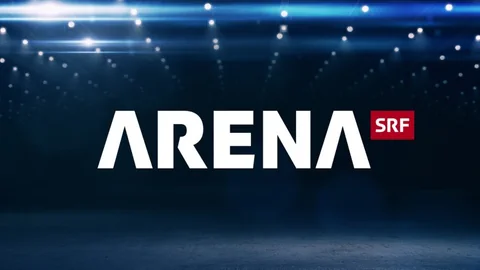In der «Arena» dreht sich die Diskussion zunächst mal um Definitionen: Um die Konkordanz, ob arithmetisch oder inhaltlich, und um die Zauberformel für die Zusammensetzung des Bundesrats.
Jacqueline Badran holt dazu weit aus und gibt zu Bedenken, wie lange es brauchte, bis die Sozialdemokraten in den Bundesrat einziehen konnten. Worauf sich SVP-Parteipräsident Toni Brunner erstaunt zeigt, dass gerade die SP mit dieser Argumentation nicht der notwendigen arithmetischen Konkordanz das Wort rede. Und damit den drei grössten Parteien (SVP, SP, FDP) je zwei Sitze und der viertgrössten (CVP) einen Sitz zugesteht.
Nun, «arithmetische Konkordanz» passe überhaupt nicht zusammen, interveniert Regula Stämpfli, «denn den Begriff gibt es in der Geschichte nicht. Konkordanz, von ‹concordare›, ist in einem vielsprachigen Staat und damit im Föderalismus entstanden.» Wenn nun Konkordanz gefordert werde, brauche es Kandidaten für den Bundesrat, die für die ganze Schweiz stehen. Sie habe den Eindruck, dass die Schweiz jetzt auch in ein Zweiparteien-System wechseln wolle.
Konkordanz trotz politischer Opposition
Er wolle in der Diskussion nicht die Sozialdemokratie verteidigen, sagt Brunner. Aber genau dass die Linke mit zwei Sitzen im Bundesrat eingebunden sei, entspreche ja auch der Konkordanz. Und das, obwohl die SP in vielen Punkten ständig in der Opposition stehe.
Zur Konkordanz gehöre aber auch das Verhalten der Partei, die in die Regierung wolle, meint Hans Grunder. Noch vor 10 oder 15 Jahren sei die SVP eine staatstragende Partei gewesen. «Dieses Bekenntnis fehlt heute. Die SVP hat zwar einen Bundesrat, aber mit einem Bein macht ihr Opposition, mit dem anderen seid ihr in der Regierung.»
Politisches Programm statt Köpfe
Es gehe doch nicht um Köpfe beim Bundesrat, betont Stämpfli. «Sondern um das Gestaltungspotenzial der schweizerischen Regierung.» Dazu gehöre eine Auslegeordnung, die zeige, was es bringe, wenn die SVP zwei Bundesräte in der Regierung habe. Oder wenn sie nur mit einer Bundesrätin vertreten wäre.
Auch für Urs Paul Engeler braucht es nicht «den Kandidaten», der als einzelne Person alle Landesteile abdecken müsse. Die Parteien mit ihrem politischen Gewicht zum Lancieren von Initiativen und Referenden müssen vertreten sind. «Und dann soll so die Regierung als konkordante Institution funktionieren – also nicht sieben Gleichgeartete, sondern sieben total Verschiedene.»
Jede Partei müsse die Leute bringen, von denen sie überzeugt sei, dass sie ihre Politik am besten vertreten. «Wenn man das nicht will, sollte man ehrlicherweise ein Konkurrenzsystem von Regierung und Opposition einführen», so Engeler.
Parteisoldat oder Staatsmann
In der Arena diskutieren die Gesprächsteilnehmer auch über mögliche SVP-Kandidaten oder eher «politischen Typen»: vom «Hardliner» bis zum «Wählbaren». Aber die Diskussion zeigt: Die Frage nach dem Anspruch der SVP auf einen zweiten Bundesratssitz ist kaum bestritten. Aber im Zentrum steht die Persönlichkeit eines Kandidaten, der kompromissbereit in der Regierung mitarbeiten soll. «Will ich weiterhin Parteisoldat sein, was die meistens sind, oder will ich Staatsmann werden», wie es Martin Candinas an die Adresse der SVP formuliert.
Es sei lange eine «Seuche in diesem Parlament gewesen», einer anderen Partei etwas (jemanden) «einzubremsen», beklagt Brunner die Erfahrungen aus früheren Bundesratswahlen. Was die Partei möchte und mit ihr die knapp 30 Prozent, die SVP gewählt haben, sei es, dass ihre politische Position am Regierungstisch diskutiert wird. «Und da ist natürlich einer allein isoliert.»
Dass dann noch gesagt werde, die vorgeschlagenen Kandidaten der SVP genügten nicht für den Bundesrat, missfällt Brunner: «Mit Verlaub, alles was wir bieten, wird denen, die schon im Bundesrat sind, noch lange das Wasser reichen.»