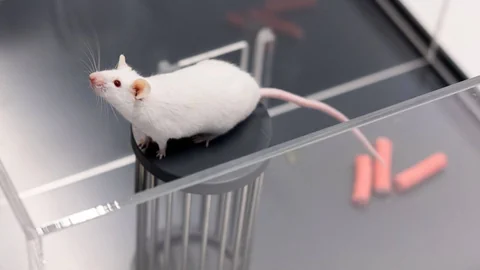In den brummenden Wärmeschränken des Labors für Stammzell-Bioengineering auf dem EPFL-Campus in Lausanne gedeihen die Zellen prächtig. 37 Grad Celsius, genügend Sauerstoff – die Bedingungen sind ähnlich wie im menschlichen Körper. Doktorand Moritz Hofer nimmt einen ca. zwei auf zwei Zentimeter kleinen Chip aus einem Inkubator und schiebt ihn unters Mikroskop. Nach einer Weile tauchen auf dem Bildschirm seltsame runde Gebilde auf.
«Das sind nun die sogenannten Organoide», sagt Hofer. Organoide sind organähnliche Strukturen, die in Zellkulturen gewachsen sind, aus Stammzellen. Stammzellen sind jene Zellen, die noch keine oder nur geringe Differenzierung aufweisen. Durch Teilung differenzieren sie sich mit der Zeit zu verschiedenen Zelltypen, die im Körper eine spezifische Funktion haben, etwa als Herz- oder Nierenzellen, Muskelzellen oder Neuronen.
-
Bild 1 von 3. Organoide, die nicht grösser sind als ein Pfefferkorn, haben in den letzten zehn Jahren die Stammzellenforschung revolutioniert. Bildquelle: Saba Rezakhani, Lütolf lab/EPFL.
-
Bild 2 von 3. Die Mini-Organe bieten unvergleichliche Perspektiven für die personalisierte Medizin, die Krebsbehandlung und die Modellierung von Krankheiten. Bildquelle: Saba Rezakhani, Lütolf lab/EPFL.
-
Bild 3 von 3. Organoide sind in der Lage, die gleichen Mutationen zu exprimieren wie die ursprünglichen Zellen, die dem kranken Gewebe eines Patienten entnommen wurden. Bildquelle: Saba Rezakhani, Lütolf lab/EPFL.
Die auf dem Bildschirm schwebenden Organoide sind von Stammzellen aus dem menschlichen Magen-Darm-Trakt gezüchtet worden, erklärt Moritz Hofer weiter. Wie ein Darm sehen die Strukturen auf dem Monitor allerdings nicht aus. Eher wie Zellhaufen. Nicht durchblutet, nicht enerviert. Für die Forscher sind diese Gebilde jedoch hochinteressant: An ihnen können sie zum Beispiel untersuchen, wie die Zelloberflächen auf Medikamente reagieren oder wie sie mit Bakterien interagieren.
Bei der Salmonellen-Infektion zuschauen
Seit gut zehn Jahren sind Organoide der heimliche Hype in den Biolabors: In der Petrischale gewachsene Herzen, Gehirne oder Darmabschnitte, die kaum grösser sind als ein Pfefferkorn. Dass solche «Modellorganismen» Tierversuche ersetzen könnten, wie manche hoffen, ist zwar nach heutigem Forschungsstand unrealistisch. Doch Organoide bieten vielversprechende Möglichkeiten, um Krankheiten wie etwa Krebs viel direkter als mit herkömmlichen Modellen zu simulieren und somit besser zu verstehen. Auch für die personalisierte Medizin sind Organoide ein Hoffnungsträger.
Matthias Lütolf ist Bioingenieur und Professor an der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne. 2007 begann der gebürtige Innerschwyzer mit dem Aufbau seines Labors für Stammzell-Bioengineering, das heute in der Schweiz zu den führenden Einrichtungen in der Organoid-Forschung gehört.
Wie funktioniert das Simulieren von Krankheiten an Organoiden?
«Wir können zum Beispiel auf das 3-D-Gewebe Bakterien geben, etwa Salmonellen, und dann dem Infektionsgeschehen unter dem Mikroskop zuschauen», erklärt Lütolf. Dynamische Prozesse wie eben eine Infektion seien im Tier sehr schwierig zu untersuchen. Auch herkömmliche Zell- und Gewebeproben böten lediglich «Schnappschüsse», die das biologische Geschehen sehr begrenzt wiedergeben.
Wir können zum Beispiel auf das 3-D-Gewebe Bakterien geben, etwa Salmonellen, und dann dem Infektionsgeschehen unter dem Mikroskop zuschauen.
«Bei den Organoiden hingegen können wir direkt am lebendigen Gewebe Untersuchungen vornehmen, und wir können die ganze Dynamik dieser komplexen Biologie quasi in Echtzeit beobachten. Dadurch eröffnen sich ganz neue Perspektiven – man sieht dann manche Dinge wirklich zum ersten Mal.»
Organs on a chip
Matthias Lütolf schiebt einen anderen Chip unters Mikroskop. Auf dem Monitor erscheint eine Röhre, die auf beiden Seiten Aussackungen hat: «ein Minidarm», sagt der Forscher. Ein Minidarm allerdings, der in der Zellkultur nicht von sich aus so gewachsen ist, sondern in einem röhrenförmigen Chip. «Wir benutzen ein spezielles Biomaterial, das wir selbst entwickelt haben, und formen es mit Laser so, dass es eine ähnliche Struktur hat wie der natürliche Darm mit seinen unzähligen Zotten und Falten», erklärt Lütolf.
Die schlauchförmigen Minidärme dienen zum Beispiel als Modell, um die Besiedlung der Darmflora mit Bakterien zu simulieren. So lässt sich dann quasi live beobachten, wie ein Mikrobiom entsteht.
Auch mit Krebszellen experimentieren die EPFL-Forscher inzwischen. Einer von ihnen ist der Spanier Luis Francisco Lorenzo Martin, den im Labor alle «Fran» nennen. Fran erklärt, die herkömmlichen 2-D-Zellkulturen seien kaum geeignet, um Krebs zu erforschen: «Die meisten In-vitro-Modelle haben nur eine kurze Lebensdauer, während Krebs im Körper relativ langsam wächst.» Deshalb hätten sie nach Alternativen gesucht – und die Organoide bewährten sich als Modellorganismen hervorragend.
Krebsforscher Fran erzählt: «Wir besiedeln den Minidarm mit gesunden Darmzellen, dann induzieren wir Mutationen, also Krebszellen. So können wir beobachten, wie der Krebs sich entwickelt und untersuchen, was den Tumor dazu bringt zu wachsen.»
Ein junges Forschungsfeld
Organoide sind ein noch relativ junges Forschungsgebiet. Als einer der Pioniere gilt der Niederländer Hans Clever: 2009 veröffentlichte der Immunologe und Molekulargenetiker in der Fachzeitschrift Nature ein bahnbrechendes Paper zusammen mit dem Japaner Toshiro Sato. Bald begann sich in Europa eine schlagkräftige und innovative Organoid-Forschung zu etablieren, «Clevers Labor in Utrecht wirkte wie ein Magnet», erinnert sich Matthias Lütolf.
Ganz vorne dabei war von Anfang an die Schweiz. «Die Schweiz ist mittlerweile ein Hotspot für Organoide», sagt Matthias Lütolf. An den grossen Universitäten seien in den letzten Jahren «Top-Leute» rekrutiert worden, und es werde viel Geld in diese Forschung investiert.
Matthias Lütolf selbst hat vor über zehn Jahren begonnen, seine Stammzellforschung auf Organoide zu fokussieren. Warum das Gebiet für ihn so spannend ist, erklärt er so: «Organoide bieten die Möglichkeit, Modelle zu machen für Krankheiten, die bisher nicht oder nur unzureichend behandelt werden können.» Für ihn sei dies die grösste Motivation.
Das hat Lütolf auch dazu bewogen, mit einem Bein in die industrielle und somit angewandte Forschung einzusteigen: Neben seiner EPFL-Professur ist er seit Juni 2021 wissenschaftlicher Direktor des neu gegründeten «Roche Institute for Translational Bioengineering» in Basel.
Der Schwerpunkt liege auf weit verbreiteten Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer. Hier erhofft sich Lütolf viel von seinem «Roche-Abenteuer», wie er es nennt: «Wenn wir es zum Beispiel schaffen würden, im Labor das Hirn eines Alzheimer-Patienten nachzubauen, dann würde das einen riesigen Impact haben und die Alzheimer-Forschung enorm befeuern.»
Roche habe unter den grossen Firmen eine Vorreiterrolle in der Organoid-Forschung eingenommen. Daneben ist eine Vielzahl von Start-up-Unternehmen auf dem Gebiet aktiv, die von der Industrie umgarnt werden. Auch aus Lütolfs Labor an der EPFL ist ein Spin-off hervorgegangen.
Organoide statt Tierversuche?
Organoide haben in letzter Zeit noch aus anderen Gründen viel Aufmerksamkeit bekommen: Viele erhoffen sich von ihnen eine Alternative zu Tierversuchen in der Forschung.
Forscher Matthias Lütolf meint dazu, es gelte, sorgfältig zu differenzieren. Tatsächlich sei es so, dass Tiermodelle für die Forschung begrenzt seien, etwa für Krankheiten, die das komplexe menschliche Immunsystem betreffen. «Da kann es durchaus Möglichkeiten geben, wie man direkt mit Organoiden, also mit menschlichem Material Modelle kreiert, die besser sind als ein Tiermodell.»
Hinter diese Aussage schiebt der Forscher jedoch ein grosses Aber: Die meisten Organoide könnten erst ein Gewebe eines Organs – das aus ganz vielen verschiedenen Gewebe bestehe – im Labor nachahmen. Ein ganzes Organ herzustellen, das sei Zukunftsmusik. Und selbst wenn das gelinge, sei man noch nicht am Ziel. «Das komplexe Zusammenspiel der Organe im Körper können Organoide noch lange nicht abbilden.» Das heisst: Man ist immer noch weit weg von einem ganzen Organismus. Deshalb brauche es Tiermodelle weiterhin.
Ethische Grenzen
Es gibt andere Aspekte seiner Forschung, die Matthias Lütolf beschäftigen. Und die haben mit den Zellen an sich zu tun, mit ihrer Herkunft: Seine Gruppe arbeitet für die Mini-Organe zwar mehrheitlich mit adulten Stammzellen, aber auch mit Stammzellen aus Embryos.
In einem Experiment wollten er und sein Team mit Organoiden die embryonale Entwicklung von Herzmuskelzellen imitieren. Sie arbeiteten dafür mit Mäuse-Stammzellen. Lütolf erzählt: «In einem unserer Modelle bemerkten wir plötzlich pulsierende Zonen mit regelmässigen Frequenzen, jede Sekunde gabs einen Schlag.» Auf dem Mikrochip, umgeben von der biologischen Nährlösung, hatte sich spontan ein winziger Herzmuskel entwickelt. «Wir schauten uns das genauer an und optimierten das Modell, und allmählich dämmerte uns die Erkenntnis: Mit diesem Modell könnten wir – theoretisch – auch ein menschliches Embryo-Herz züchten.»
Inzwischen arbeitet Lütolfs Gruppe tatsächlich an einem menschlichen Modell. Es scheine ähnlich gut zu funktionieren wie bei der Maus.
Ein embryonales Herz, gezüchtet aus menschlichen embryonalen Stammzellen: Darf man das tun? Was ist mit jenen Labors, die an sogenannten Embryoiden arbeiten, kleinen lebenden embryoähnlichen Systemen - von denen sich Forschende neue Einblicke in die frühe menschliche Embryonal-Entwicklung erhoffen? Wie weit dürfen Forscher gehen? Gibt es Grenzen bei den Organoiden, auch wenn man dies für wichtige Forschung hält? Das sind die Fragen, die Matthias Lütolf umtreiben, zu denen er keine Antworten hat. Und über solche Fragen wünscht er sich eine öffentliche Diskussion.