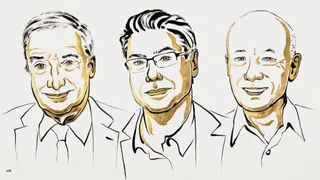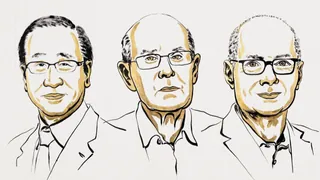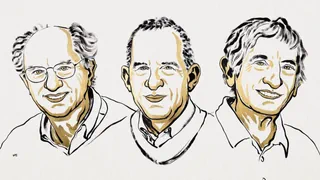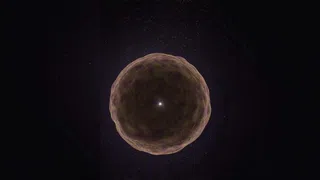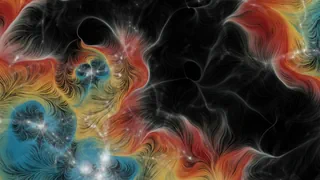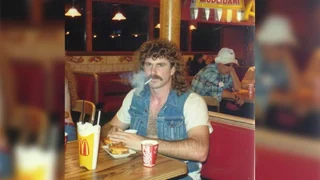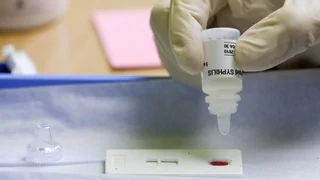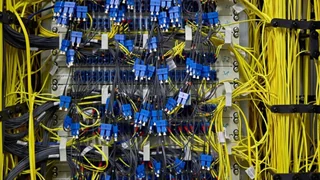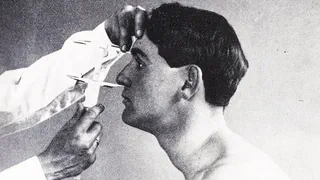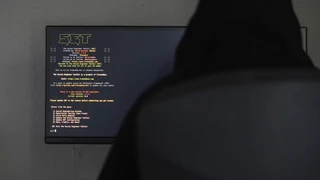News zum Thema Forschung & Technik
Nobelpreise 2025
Chancen und Grenzen von KI
Künstliche Intelligenz ist das Wort der Stunde. Was hat sie uns zu bieten und was macht sie mit uns?
Was uns bewegt, wenn wir uns bewegen
Mobil sein ist eine Grundvoraussetzung für unseren Lebensstil. Wie wir das tun, verändert sich gerade fundamental.
Testen Sie Ihr Wissen
Überraschend und unterhaltsam: Aha-Erlebnisse im Wissens-Quiz.
Auf einen Schlag im Dunkeln
Stromausfälle gibt es doch nur im Ausland. Und wenn es uns doch einmal trifft?